
The Project Gutenberg eBook of Zwanzig Jahre an Indischen Fürstenhöfen, by Otto Mayer
Title: Zwanzig Jahre an Indischen Fürstenhöfen
Indisches und Allzu-Indisches
Author: Otto Mayer
Editor: F. R. Nord
Release Date: March 23, 2023 [eBook #70353]
Language: German
Produced by: The Online Distributed Proofreading Team at https://www.pgdp.net
Anmerkungen zur Transkription
Der vorliegende Text wurde anhand der Buchausgabe von 1922 so weit wie möglich originalgetreu wiedergegeben. Typographische Fehler wurden stillschweigend korrigiert. Ungewöhnliche und heute nicht mehr verwendete Schreibweisen bleiben gegenüber dem Original unverändert; fremdsprachliche Ausdrücke wurden nicht korrigiert. Schreibweisen von Personen- und Ortsnamen wurden nicht vereinheitlicht.
Das Original wurde in Frakturschrift gesetzt; Passagen in Antiquaschrift werden hier kursiv dargestellt. Abhängig von der im jeweiligen Lesegerät installierten Schriftart können die im Original gesperrt gedruckten Passagen gesperrt, in serifenloser Schrift, oder aber sowohl serifenlos als auch gesperrt erscheinen.

Zwanzig Jahre
an Indischen Fürstenhöfen
*

Indisches und Allzu-Indisches
von
Otto Mayer
Bearbeitet und herausgegeben
von
F. R. Nord
Mit 31 Bildtafeln

1922
Verlag Deutsche Buchwerkstätten
Dresden
Alle Rechte, insbesondere das der
Übersetzung, vorbehalten.
Copyright 1922 by Verlag Deutsche Buchwerkstätten, Dresden.
Druck von Oscar Brandstetter in Leipzig.


[S. V]
|
Seite
|
||
|
Vorwort
|
||
|
I.
|
Kapitel. Von Sansibar über London nach Indien
|
|
|
II.
|
Kapitel. Am Hofe des Maharadscha von Baroda
|
|
|
III.
|
Kapitel. Die „Gaekwar“ von Baroda
|
|
|
IV.
|
Kapitel. Der Maharadscha von Kapurthala
|
|
|
V.
|
Kapitel. Die Rani Kanari
|
|
|
VI.
|
Kapitel. Die Rani Umedi
|
|
|
VII.
|
Kapitel. Anglo-Indisches
|
|
|
Antilopenjagden
|
||
|
Jagdhunde in Indien
|
||
|
Eberjagden
|
||
|
Jagdpferde
|
||
|
Rennpferde: Foxy, Mite, Mulberry
|
||
|
Jockeys
|
||
|
VIII.
|
Kapitel. Hindu-Indisches
|
|
|
Wildenten
|
||
|
Wachteln
|
||
|
Wilde Elefanten
|
||
|
Zahme Elefanten
|
||
|
Die Tollwut in Indien
|
||
|
Hungersnot
|
||
|
Pferdeschau
|
||
|
Heilige Tiere: Kuh, Ameise, Affe, Schlange
|
||
|
Gaukler
|
||
|
Pythonschlange
|
||
|
IX.
|
Kapitel. Indische Menschen
|
|
|
Allgemeines
|
||
|
Kriegerische Inder
|
||
|
Brahminen
|
||
|
Minister
|
||
|
[S. VI]
Lebensalter
|
||
|
Eitelkeit
|
||
|
Eine Staatskarosse
|
||
|
Maharadscha
|
||
|
Daulet Ram
|
||
|
Der Hausorden
|
||
|
„Ab ke bas hai“
|
||
|
Fürstliche Kaufgewohnheiten
|
||
|
Der Nisam von Haiderabad
|
||
|
Jakob von Simla
|
||
|
Der Holkar von Indore
|
||
|
Barbiere in Indien
|
||
|
Als „Tasildar“ in der Peststadt
|
||
|
Inder als Gäste
|
||
|
Tanzmädchen
|
||
|
Indische Diebe
|
||
|
Schlußbemerkungen
|
||

[S. vii]
Unter den vielen europäischen Reisenden, die Indien seither besucht haben, hatten nur wenige Auserwählte Gelegenheit, in nähere Berührung mit den indischen Fürstenhöfen zu kommen. Diese Wenigen haben meist auch nur die Lebensgewohnheiten der orientalischen Herrscher in dem prunkhaften Glanze der Empfänge und Lustbarkeiten zu beobachten Gelegenheit gehabt. Otto Mayer hingegen, der Aufzeichner des vorliegenden Werkes, wurde durch eine seltene Verkettung von Umständen dazu ausersehen, zwanzig Jahre lang an den Höfen zu Baroda und Kapurthala als Palast-Vorsteher und Berater eine seltene, für einen Deutschen außerordentliche Stellung einzunehmen. Daß er bei dieser Gelegenheit vieles beobachten konnte, was andere Reisende nicht sehen und erleben und daß er Fürsten und Volk, dank seines jahrzehntelangen Wirkens in Indien, auch von der menschlichen und allzumenschlichen Seite kennen lernte, liegt auf der Hand. So bilden denn seine Memoiren einen nicht zu unterschätzenden Beitrag zur Kenntnis der indischen Psychologie, des indischen Lebens und Landes, von dem man im allgemeinen nur zu sehr geneigt ist, sich eine ganz falsche, meistens stark idealistisch gefärbte Vorstellung zu machen. Durch langjährige und ausgedehnte Reisen in allen Teilen Asiens auch mit indischen Verhältnissen vertraut, habe ich die seltsamen Erlebnisse Otto Mayers in die Form gebracht, in der sie im Nachstehenden dem Leser vorgelegt werden.
F. R. Nord.


[S. 1]

Über das von einem feinen Regen schlüpfrige Holzpflaster Regent Streets rollten auf ihren hohen, dünnen Gummirädern die ‚Hansoms‘ in langer Reihe. Die schwarzen Umhänge der hoch oben über den zweirädrigen Wagen thronenden „cabbies“ trieften vor Nässe. Vom Nebel verschleiert schienen die Gestalten von Pferd und Wagen und Kutscher seltsame Schatten, die lautlos durch ein graues trübes Licht ziellos und zwecklos sich bewegten. Und unter die Nebelgestalten der Hansomwagen mischten sich die schweren Omnibusse aller Linien Londons, die von Oxford Circus nach Piccadilly Circus mit dumpfem Einerlei im müden Aufschlag der Hufe ihrer Pferde rollten oder von Haymarket heraufkommend Regent Park zustrebten.
Um den kleinen, schäbigen Brunnen, der Piccadilly Circus „verziert“, saßen Blumenverkäuferinnen unter breiten Schirmen[S. 2] und boten den hastig Vorübereilenden hoffnungslos die tropfenden Blüten des Herbstes von 1889 an. Die hohen Häuser der in breitem Bogen nordwärts verlaufenden Straße verloren sich im Grau des Himmels, und die sonst von reichem und glänzendem Leben erfüllten Fußsteige bevölkerten armselig gekleidete graue Gestalten. Die Männer mit heraufgeschlagenen Kragen trugen ihre Hände frierend in den abgenutzten Taschen ihrer dünnen Überzieher, und die Zahl der Frauen in Umschlagtüchern und im Schmutz der Straße schleppenden Röcke schien unendlich. —
Das war das Bild, das sich mir vom Fenster meines Arbeitszimmers in dem von mir geleiteten Restaurant Café Royal, dem größten des Londons jener Tage, bot. Mißmutig, abgespannt und müde blickte ich an jenem Novembermorgen auf die vor mir liegenden Abrechnungen, Bestellungen, Muster, Vorratslisten, Ergänzungsaufstellungen und die ganze Schreibarbeit, die die Führung eines großen, weltbekannten Hauses tagtäglich auf meinem Schreibtische sich ansammeln ließ.
Ich dachte der Tage, die anscheinend schon Jahrzehnte zurücklagen, und von denen mich doch kaum zwölf Monate trennten, als ich in der heißen, sonnendurchglühten Luft Sansibars auf der Veranda des Hotels Criterion stand, dessen Direktor ich damals gewesen war. Wo waren sie hin, die süßen Düfte der tausend Blüten und Blumen jener tropischen Insel, die scharfen aromatischen Gerüche des farbenbunten Orients? Wehten noch die kühlen Winde vom Meer flüsternd in den Palmen? und war die Musik verstummt, die leicht und schwebend durch die sternglänzenden Nächte aus dem Dunkel meiner Gärten klang, getragen von dem unfernen dumpfen Brausen der schäumenden Wellen des indischen Ozeans?
Und die Menschen jener Tage, meine Gäste, meine Freunde, gute Bekannte, wo mochten sie sein? Dunkle portugiesische Händler, blonde Kaufleute aus Deutschland und England, lachende Offiziere der Kriegsschiffe aller Völker, die Sansibar anliefen, das damals im Mittelpunkte so vieler Interessen stand, gleichmütige[S. 3] Weltenbummler aus allen Ländern des fernen Europa! Jeder hatte ein Anliegen, eine Frage. Jedem mußte ich irgendwie behilflich sein. Und mein Freund aus den Staaten, der unternehmungslustige Mann mit dem sonderbaren Namen: Vizetelli, der eines Tages als Vertreter des „New York Herald“ vom Winde des Schicksals mir zugeweht worden war! Er wollte, er mußte Emin Pascha entgegenziehen, Emin Pascha, der sagenumwoben tief im Sudan, tief im Innern des Schwarzen Erdteils allein Ordnung, Recht und Ruhe aufrecht erhielt. Der Ruhm Stanleys ließ Vizetelli nicht schlafen. Hatte Stanley Livingstone gefunden, so wollte Vizetelli doch wenigstens dem mächtigen Emir, Emin Pascha, entgegenziehen. Und er ließ keine Ruhe; ich mußte ihn begleiten. Verführt von seinem Enthusiasmus willigte ich ein. Zusammen brachen wir auf. Mühsam war die Reise auf dem Festlande landeinwärts. Fieber überfiel uns. Ungewohnt der Strapazen, unerfahren im Leben einer auf sich selbst gestellten Expedition, gaben wir unser Vorhaben doch nicht auf. Trotz Ermüdung, trotz Krankheit und Unglücksfällen aller Art gingen wir im jugendlichen Starrsinn eines einmal gefaßten Entschlusses immer weiter, — bis der Zusammenbruch kam. Vizetelli fand sein Grab in dem heute, ach, so fernen Ostafrika! Sein stark geschwächtes Herz funktionierte nicht mehr richtig. Das Fieber schüttelte ihn. Auf einmal lag er still. Das kranke Organ hatte seine Arbeit eingestellt. Mit Mühe erreichte ich die Küste; mit Mühe schiffte ich mich müde und in aller Lebenskraft gebrochen ein; müde erreichte ich England.
Als es mir etwas besser ging, übernahm ich die schon früher innegehabte Stellung als Leiter des Restaurant Café Royal in Regent Street, London, dem grauen, trüben, feuchten London eines grauen, trüben, feuchten November. Doch wer einmal den Orient erlebt hat, wem einmal die heiße Sonne seines fremden Himmels das Blut erwärmte, trägt die Sehnsucht nach ihm stets in sich. Seine Bilder liegen fest eingegraben in der Erinnerung, und durch alles Geschehen der blassen, kühlen Tage des Nordens[S. 4] leuchten sie wie durch einen Schleier, stempeln alles Tun und Treiben zu einem Schatten, einem unwirklichen, wesenlosen Traum, hinter dem das Leben der Sonnenländer ewig lockt und winkt.
So winkten auch mir die verschleierten Gestalten des Morgenlandes, seine buntgekleideten Männer, durch den Nebel Londons ernst und still zu. Hinter den Regenwolken standen — sah ich sie doch ganz genau — die hohen Palmen im Lichte der strahlenden Sonne, und zwischen den Papieren meines Schreibtisches rauschten die Blätter der Bäume meines Gartens am Hotel Criterion in Sansibar, und die Düfte seiner Blüten hingen schwer und sehnsüchtig über dem Dunst meines Kohlenfeuers im Kamin.
Da wurde mir ein Landsmann gemeldet, einer, dessen Lebensarbeit auch jenseits von Suez lag, der Besitzer zweier großer Hotels in Indien, des Charleville-Hotel in Mussoorie und des Hotel Royal in Lucknow. Erfreut ließ ich ihn eintreten, an diesem trüben Novembertage doppelt willkommen.
Doch wie groß war mein Erstaunen und meine Freude, als er mir den Vorschlag machte, meine Stellung in London aufzugeben und die Leitung seiner Hotels in Indien zu übernehmen. Keinen besseren Tag als diesen hätte er aussuchen können, um mich zu gewinnen. Ohne Zögern nahm ich an. Doch sein Vorschlag hatte einen besonderen Grund.
Seine Königliche Hoheit, der Herzog von Clarence, sollte mit einem großen Gefolge das indische Kaiserreich zur Erhöhung des britischen Ansehens und zur eigenen Unterhaltung besuchen, wobei er natürlich die verschiedensten einheimischen Fürsten mit seinem Besuche „beehren“ würde.
Diese Besuche erfolgen jedoch nicht auf Einladung des betreffenden Fürsten hin, sondern der ‚Sirkar‘ (die britische Regierung in Indien) erweist ihnen die Gnade, einen englischen Prinzen oder Würdenträger bewirten zu dürfen. Inwieweit dies dem so Ausgezeichneten angenehm ist, kommt überhaupt nicht in Frage.
Da nun aber an diesen einheimischen Höfen nichts, aber auch[S. 5] gar nichts für die Unterbringung oder Verpflegung europäischer Gäste vorhanden ist, und da die englischen Herren und Damen mit Entrüstung jedes Eingehen auf eine Teilnahme an den Sitten und Gepflogenheiten des Landes ablehnen würden, so ist angeordnet worden, daß, wo immer der Sirkar das Stattfinden eines solchen Besuches bestimmt, die Bewirtung zwar auf Kosten des unfreiwilligen Gastgebers zu erfolgen hat, aber in allen Einzelheiten von der anglo-indischen Regierung aus geliefert wird. Die Ausführung wird dabei natürlich einem Fachmanne übertragen, der an allen diesen indischen Höfen die notwendigen Vorkehrungen zu treffen hat, um während der Dauer des Aufenthalts der hohen englischen Gäste für deren leibliches Wohlbefinden — immer auf Kosten des betreffenden Fürsten — zu sorgen.
Dieser Auftrag war nun für die Reise des Herzogs von Clarence meinem Freunde erteilt worden, der mich mit den Vorbereitungen, der Durchführung und Überwachung der Verpflegung des herzoglichen Reisevölkchens in Indien beauftragte. Denn es handelt sich bei solchen Veranstaltungen stets um eine ziemliche Anzahl von Personen, da zu dem Gefolge eine beträchtliche Dienerschar gehört. Fünfzig und noch mehr Menschen, die zu solchen Besuchsreisen mitgenommen werden, sind keine Seltenheit.
Wenn man bedenkt, daß vom Bettzeug bis zur Tischwäsche, vom Zahnstocher bis zum Weinglas, vom Kochtopf und der Bratpfanne bis zum Abwischtuch, von den Blumenvasen bis zur Eismaschine alles und jedes nicht nur vorhanden sein, sondern auch stets zur rechten Zeit und am rechten Ort vollständig ausgepackt und verwendungsbereit stehen muß, so wird auch der Laie sich einen Begriff von dem machen können, was diese Arbeit bedeutet.
Dazu kommt noch, daß nicht wahllos irgendwelches Geschirr genommen werden darf. Alles muß dem Range der betreffenden Reisenden angepaßt werden, und innerhalb des Gefolges wieder entsprechend abgestuft sein. Zu den europäischen Begleitern einer solchen Reisegesellschaft gehört aber auf indischem Boden noch ein ganzer Troß einheimischer Diener, von denen ein jeder nur[S. 6] einen ganz bestimmten Handgriff tut, denn alle anderen sind einem Angehörigen einer höheren oder niedereren Kaste vorbehalten. Und den einen Handgriff, der einem Jeden obliegt, tut er selbstverständlich auch nur, wenn es sich gar nicht mehr umgehen läßt. Nur bei den Mahlzeiten sind alle pünktlich zur Stelle, die jedoch ein jeder ebenfalls wieder nur für sich allein, oft auch noch unter Ausschluß jeder Berührung mit den Speisen der anderen zubereitet, verlangt.
Ich hatte also mit den Vorbereitungen dieser Verpflegungsangelegenheit die nächsten Wochen hindurch vollauf zu tun. Trotzdem gelang es mir, schon im Januar 1890 über Triest nach Indien abzureisen, wo ich mich sofort nach der herrlich im Himalaja gelegenen Bergfrische Mussoorie begab, um die Leitung des Hotels Charleville dort zu übernehmen und die im Lande selbst zu treffenden Vorkehrungen für die Reise Seiner Königlichen Hoheit des Herzogs von Clarence in die Wege zu leiten, für Transport und Diener zu sorgen, mir Einzelheiten über die an den verschiedenen Höfen zur Aufnahme der Gäste bestimmten Räumlichkeiten zu verschaffen und mit den behördlichen Stellen Fühlung zu nehmen, in deren Hand die Leitung der Reise selbst lag.
Der Aufenthalt in der Höhenluft des 2000 Meter hoch gelegenen Mussoorie gab mir bald meine frühere jugendliche Spannkraft zurück, die der Zug mit dem unglücklichen Vizetelli vom New York Herald, Emin Pascha entgegen, bis ins Innerste erschüttert hatte.
In Mussoorie, wie in allen Bergfrischen des Himalaja, beginnt die Fremdenzeit im April, um den ganzen, im Tieflande unerträglichen, heißen Sommer über zu dauern. Mussoorie ist ein von den englischen Beamten besonders bevorzugter Ort, weil sich dort das Leben viel freier abspielen kann als in den offiziellen Erholungsplätzen wie Simla und Dardschieling, wo der Vizekönig von Indien residiert und wo es von Gouverneuren und kommandierenden Generälen wimmelt, die zu einem Teile auch Orte wie[S. 7] Naini Tal und Murrie unsicher machen. An Unterhaltung bietet Mussoorie eine mehr als große Auswahl. Ein Liebhaber-Theater, auf dessen Bühne sich hin und wieder eine australische Berufsschauspielertruppe verirrt, sammelt die mehr ästhetisch Veranlagten; eine Rollschlittschuhbahn bietet den mehr körperliche Bewegung Vorziehenden Gelegenheit zur Betätigung, und eine Rennbahn von allerdings nur 400 Meter Auslauf gestattet doch das Abhalten von Gymkhanas, von Polospielen und Ponyrennen.
Gegen den Herbst sollte die Rundreise des englischen Prinzen, deren Verpflegungsteil ich zu leiten hatte, beginnen. Zunächst war vorgesehen, den großen Maharatten-Staat Gwalior zu beglücken, daran anschließend die Staaten von Dschaipur und Dschodhpur, worauf Baroda und Mysore an der Reihe waren, im Lichte der hohen Gegenwart zu erglänzen.
Alle diese Staaten sind Hindustaaten, wo das heiligste aller heiligen Tiere die Kuh ist, deren Schlachten mehr als einen Mord bedeutet, denn es kann nur mit dem Tode zwar nicht gesühnt, aber bestraft werden, während das Töten eines Menschen weniger hart unter das Gesetz fällt. Die Folge dieser religiösen Anschauung nun brachte es mit sich, daß ich von den mit der Ehre des Besuches bedachten Staaten aus bestürmt wurde, doch ja die Gefühle der Fürsten und ihrer Untertanen zu schonen und kein Rindfleisch einzuführen. Um den weißen Gästen seinen Genuß zu ersetzen, war der „Durbar“, das jeörtliche fürstliche Ministerium, bereit, mir so viel Hammelfleisch, Geflügel und Wild zur Verfügung zu stellen, als ich nur wünsche. Außerdem lieferten die Staaten Fische, Geflügel und Brennholz in großen Mengen, was alles aber bei der mit der Regierung im voraus abgemachten Verpflegungspauschale überhaupt nicht in Betracht gezogen wurde, und das der indische Fürst ja so wie so zu begleichen hatte. Die Verpflegung eines solchen fürstlichen Wanderlagers bietet daher dem Unternehmer recht annehmbare Vorteile, wie es ja in Indien immer ein erträgliches Geschäft bleibt, mit den Fürsten des Landes zu tun zu haben, noch dazu im Auftrage[S. 8] der „paramount power“, der „vorherrschenden Macht“, wie der Engländer sich hohnvoll angesichts der Machtlosigkeit der indischen Staatengebilde auszudrücken pflegt.
Gegen den Schluß unserer Rundreise in Baroda angelangt, bot sich mir die Gelegenheit, in den Dienst des dortigen Fürsten zu treten. Der englische Resident an seinem Hofe, General Sir Harry Prendergast, und seine Frau interessierten sich für mich und überzeugten den Maharadscha, daß er zur Überwachung der für seine Gäste bestimmten Paläste und zur Verpflegung seiner vielen hohen Besuche jemanden benötige, der in solchen Angelegenheiten Erfahrung, Takt und Wissen besaß.
Nachdem der Gaekwar, wie der Maharadscha von Baroda — nach dem Nisam von Haiderabad der reichste und angesehenste Fürst Indiens — mit seinem offiziellen Titel heißt, mich empfangen hatte, übertrug er mir die in Frage stehende Stellung, zu deren Annahme ich aber die Genehmigung des Vizekönigs von Indien haben mußte, denn kein indischer Fürst darf einen Europäer ohne dessen Erlaubnis in seine Dienste nehmen. Da Sir Harry Prendergast sich jedoch für mich einsetzte, machte dies weiter keine Schwierigkeiten, und ich trat meine Stellung als Palastvorsteher und Verpflegungsminister mit einem Vertrag für fünf Jahre in Baroda an, nachdem ich noch am letzten indischen Fürstenhofe, den der englische Prinz mit seinem Besuche beehrte, dem von Mysore, meines Amtes als wandernder Hoteldirektor nachgekommen war.

[S. 9]

Baroda, das östlich des Golfes von Cambay an der von Bombay nach Norden, nach Ahmedabad, und weiter durch die Radschputana-Bezirke, nach Delhi führenden Bahn liegt, ist in einer weiten fruchtbaren Ebene eingebettet. Bei seiner Thronbesteigung hatte der junge Gaekwar, der Maharadscha Siyadschi Rao sogleich nach der Sitte indischer Fürsten mit dem Bau eines mächtigen Palastes begonnen, der sicher eines der größten und schönsten, wenn nicht das schönste neuere Bauwerk dieser Art in dem an prachtvollen Gebäuden reichen Indien ist.
In einem von dichten Bäumen bestandenen Park gelegen, erhebt es seine weißglänzenden Mauern aus prächtigen Gartenanlagen, die wie ein dunkelgrüner, mit dem hellen Gelb der verschlungenen Wege gemusterter Teppich vor ihm ausgebreitet liegen. Tausende von Fenstern, deren Bögen und Säulen in überall[S. 10] wechselnder Verschiedenheit doch zu einem harmonischen Ganzen verschmelzen, erhellen hunderte und aberhunderte von kostbar ausgestatteten Gemächern.
Die herrlich gegliederte Vorderseite mit ihren säulengetragenen Vorbauten, Türöffnungen, Türen und Fenstern wirkt durch ihre Ausdehnung mehr wie ein aus dem Grün seiner Gärten emporwachsendes Märchen, denn als die Wohnung nur zu sehr erdengebundener Menschen. Überragt von einem schlanken, hohen Turm, mit schön durchbrochener Kuppellaterne gekrönt, scheinen die vielen, verschieden geformten Dachtürme nur wie Blumen, die den Stamm einer Rose umgeben.
Dieser Palast, das „Schloß des Glückes“, ‚Luxmi Vilas‘ geheißen, wurde mir bei meinem Dienstantritt in Baroda zur Ordnung der Innenräume überwiesen. Als ich ankam, waren die Zimmer mit aller Art der wertvollsten Möbel ohne jeden Gedanken einer sinngemäßen Zusammengehörigkeit vollgestellt. Goldstrotzende französische Saloneinrichtungen standen kunterbunt mit schweren englischen Eßzimmermöbeln zusammen. Lederne Klubsessel machten es sich neben breiten Messing-Bettstellen bequem. Flügel aus Palisanderholz standen neben kleinen niedrigen Sesseln einheimischer Arbeit. Auf mit seidenen Teppichen aus Buchara verhangenen Wänden hatte man riesige Spiegel in breiten Goldrahmen angebracht, und mitten im Zimmer prangte ein marmorner Waschtisch, den kupfergetriebene Kandelaber altindischer Kunst erstaunt und verlegen betrachteten.
Große Bücherschränke ohne Bücher, aber mit den sonderbarsten Gegenständen Pariser Läden gefüllt, standen auf den kühlen Treppenabsätzen, und in einer der riesigen Hallen befanden sich rings an den Wänden eine Menge zierlicher Damenschreibtische. In all dieses Wirrwarr sollte ich nun etwas wie Ordnung bringen, wozu mir ein ebenso großes wie faules Heer von Dienern zur Verfügung gestellt wurde.
Doch der Gaekwar von Baroda war in Europa gewesen. Die Sitten dieses gelobten Landes gedachte er auch seinen teuren[S. 11] Untertanen, wenn nicht aufzupfropfen, so doch in angenehm eingehender Form vor Augen zu führen. Nach vermutlich langem Nachdenken beschloß er den Anfang damit zu machen, daß er die Herren der Hofgesellschaft zunächst an die Gerichte der europäischen Küche und, damit verbunden, an die Eßgepflogenheiten der so außerordentlich zivilisierten Länder des Westens, die die Weltherrschaft unter sich teilen, gewöhnen wollte.
Mit Suppe und Braten, mit Fisch und Geflügel, mit Eis und Früchten sollte begonnen werden; doch mehr als Belohnung für die schwere Arbeit des Lernens, Messer und Löffel von Gabeln zu unterscheiden, Eis möglichst wenig durch Fischmesser zu zerlegen und Geflügelpasteten nicht nur mit Kaffeelöffeln und Messerbänkchen zu Leibe zu gehen.
Erfreut über seinen Gedanken ließ er mich kommen. Gründlich wie alle Inder wollte er aber am Anfang aller Gelage beginnen, nämlich in der Küche. Damit seine Hofgesellschaft sich an den Gebrauch von Mundtüchern gewöhne, war es vor allen Dingen erforderlich, eine vollständig ausgestattete europäische Kücheneinrichtung für das „Schloß des Glückes“ zu beschaffen, mit Herd und kupfernen Kasserolen, mit Wasserbad und Tellervorwärmer und all den Künsten einer kulinarischen Technik, wie sie sich in Europa entwickelt hat.
Ich erhielt also Befehl, alle diese Dinge kommen zu lassen und die Aufstellung zu überwachen. An Köchen und Küchenjungen, an Spülmädchen und Waschfrauen war kein Mangel. Sie gingen und kamen und wunderten sich. Hin und wieder ließ sich eins oder das andere dieser Mitglieder des Kochheeres herab, einen Handgriff zu tun. Da aber das Heer so groß war, konnte die Arbeit des einzelnen entsprechend klein sein, solange nur genug zu essen vorhanden blieb. Und daran mangelte es in der Küche des Gaekwar von Baroda nie.
Nun sollte ich, der erste und einzige Europäer, der jemals am Hofe des Gaekwar gewesen war, auch die Zubereitung!, die Zubereitung der europäischen Speisen! auf europäische Art —[S. 12] der Fürst legte, wie schon gesagt, Wert auf Gründlichkeit, und daß jedes Ding von Anfang an auch richtig angefaßt werde — überwachen.
Ich war schon dabei, mir zu überlegen, wie ich, um ganz gründlich zu verfahren, mir ein authentisches, europäisches Oberkoch-Küchenchef-Gewand beschaffen könne, als meine damals noch recht geringen Kenntnisse der indischen Sitten und Gebräuche und vor allem der komplizierten Kastenvorurteile schnell und eindringlich bereichert wurden.
So sehr der Gaekwar auch bereit war, Europäisches einzuführen, so war er trotz allem doch gezwungen, die Meinung seiner Religionsgenossen zu berücksichtigen. Dazu stand er stark unter dem Einfluß seiner Gemahlin, der Maharani, die wiederum ganz dem Drucke der gewissenlosen und hinterlistigen Brahminenpriester verfallen war.
Selbstverständlich beabsichtigten diese auf ihren Einfluß eifersüchtigen Brahminen von allem Anfang an ihr Möglichstes zu tun, um mir, dem ersten Weißen, der in die inneren Kreise des streng abgeschlossenen indischen Fürstenhofes Zutritt erlangt hatte, zu schaden.
Für sie war der Befehl des Gaekwar, ich solle die Zubereitung der Speisen für seine Europäisierungsgelage überwachen, anscheinend eine Ungeheuerlichkeit, gegen die der Untergang der Welt als nebensächliches Ereignis verblassen würde.
Als ich der erhaltenen Anordnung nachkommen wollte, trat mir der Oberhofmarschall an der Spitze sämtlicher Maharatten und Brahminen-Oberköche entgegen und bedeutete mir, unter allen Zeichen der tiefsten Erregung, daß ich die so schöne europäische Küche nicht betreten dürfe, denn dies würde gegen die Kasten-Skrupeln des Maharadscha und seiner Angehörigen, sowie der Gäste verstoßen. Die Speisen zu berühren oder zu kosten wäre gleichfalls ein Sakrilegium schlimmster Art und würde sie einfach ungenießbar machen.
Also die Küche, die ich leiten sollte, durfte ich nicht betreten,[S. 13] denn in Punkten des religiösen Zeremoniells war der Gaekwar ebenso machtlos wie etwa ich selbst.
Doch ich wollte versuchen, wenigstens im Speisesaal nach dem — europäisch — Rechten zu sehen, und mich, nachdem die Gäste von den Speisen gegessen hätten, durch Kosten von der richtigen Zubereitung überzeugen, um gegebenenfalls beim nächsten Male Übelstände abstellen zu können. Doch auch dies erwies sich als undurchführbar, da ich auch den Speisesaal nicht betreten durfte, ehe nicht alles abgedeckt war.
Folglich hatten meine Bemühungen, den Plänen des Gaekwar entgegenzukommen, wenig Aussicht auf Erfolg. Und ich sah auch sehr bald, daß den Herren der Hofgesellschaft der Gedanke ihres Gebieters keine rechte Freude bereitete.
Die ganze „Esserei“, um nicht von „Vielfresserei“ zu sprechen, hatte mit Europa kaum die Namen der Speisen gemein. Sie wurde am Anfang zweimal wöchentlich abgehalten. Doch keiner der Gäste fühlte sich glücklich, Messer und Gabel zu handhaben. Weiße wurden nie dazu eingeladen. Erst wenn der neue Gang, das unvermeidliche Nationalgericht „Curry mit Reis“, auf den Tisch kam, begannen die Gesichter der Geladenen aufzuleuchten. Jetzt konnten sie doch wenigstens sich mit Suppenlöffeln ordentliche Mengen zuführen, was ihrer Gewohnheit, sich den Mund mit den Fingern vollzustopfen, doch etwas näher kam, als die mühevolle Arbeit mit Messer und Gabel!
Doch schon das Zusammenessen an sich der verschiedenen Herren dieses Hofes bereitete die größten Schwierigkeiten. Mit dem Gaekwar zusammen saßen nur die Maharatten und Radschputen, Angehörige der Kriegerkaste. Die Parsi und die Mohamedaner saßen getrennt für sich an besonderen Tischen, die aber nicht auf demselben Teppich stehen durften. Wurden einheimische Christen eingeladen (Goanesische Staatsbeamte), so mußte auch für diese ein besonderer Tisch aufgestellt werden. Doch alle diese Letzteren durften nicht in dem gleichen Raume mit dem Gaekwar sitzen. Dies war nur den Angehörigen höherer Kasten, sowie Brahminen[S. 14] gestattet, die aber, auf ihre Würde bedacht, es mit allen Zeichen des Abscheus ablehnten, auf diese Weise zu speisen.
Mancher von ihnen jedoch, der mich in meinem Hause besuchte, nahm dort keinen Anstoß, in derselben Weise mit mir zu Tisch zu sitzen, die er im „Schloß des Glückes“ entsetzt ablehnte!
Während des Essens wurde gegessen. Dies war der augenscheinliche und nächstliegende Zweck. Zum Unterhalten hatte man noch immer Zeit. Und die nützliche Beschäftigung des Speisenverschlingens wurde nur durch die unangenehme Mühe behindert, die ein Jeder aufwenden mußte, um die anderen in der Handhabung der Bestecke zu beobachten, denn in Gegenwart des Gaekwar wollte sich keiner eines Verstoßes gegen die von dem Herrscher so hochgeachteten Gebräuche des fernen Europa zu schulden kommen lassen. Auch entschädigte ja die gute und reichliche Mahlzeit, die er ihnen als freigebiger Erzieher vorsetzen ließ, für seine sonst ziemlich unverständliche Eigentümlichkeit.
Daher lag über diesen halbwöchentlichen Erziehungsschmausereien eine sachgemäße Stille. Nur das Grunzen oder Rülpsen der Zufriedenheit des einen oder des anderen der Höflinge, der damit die baldigen Grenzen der Leistungsfähigkeit seines inneren Menschen andeuten wollte, unterbrach das laute, eintönige Schmatzen, mit dem die Minister, die hohen Staatsbeamten und Offiziere des Gaekwar von Baroda ihren vertilgerischen Lernpflichten nachkamen.
Getränke wurden bei diesen Mahlzeiten nicht gereicht, nicht einmal Wasser. Erst nach Tisch begaben sich die Gäste in den Hof des Palastes, wo die „Bisti“ — Wasserträger — ihnen am Brunnen Gelegenheit boten, sich den Mund zu spülen, was unter ohrenbetäubendem Lärm vor sich ging.
Nach einiger Zeit sah denn auch der damals noch junge Maharadscha ein, daß seine Bemühungen, durch Vermittlung seiner Hofgesellschaft europäische Begriffe unter seinen Untertanen zu verbreiten, nur zu einer Verbreiterung des Leibesumfanges der einzelnen führte, ihren Geist aber nicht zu erleuchten geeignet[S. 15] war. Daher stellte er diese kostspieligen Lehrfütterungen ein und setzte sich nur im Kreise vertrauter Freunde in europäischer Weise zu Tisch.
Mir machte er keine Vorwürfe, denn er begriff, daß ich ebensowenig wie er selbst etwas gegen die Macht der Brahminen ausrichten konnte. Ich hatte auch genug mit der Einrichtung von „Luxmi Vilas“ und der Unterbringung und Verpflegung der zahlreichen Staatsgäste, die sich in Baroda in ständiger Folge ablösten, zu tun.
Dadurch wurde mir aber Gelegenheit geboten, mich in umfassender Weise sportlich zu betätigen. Nicht nur nahm ich stets an den oft großartigen Jagden teil, deren Anordnung und Beaufsichtigung mit zu meinen Pflichten gehörte, sondern als Mitglied des ‚Baroda Polo Team‘, der einer der besten im westlichen Indien war, gelangte ich in diesem ebenso aufregenden wie höchstes Reitgeschick erfordernden Spiele bald zu großer Fertigkeit.
Doch dies waren nur die ersten oberflächlichen Eindrücke eines Neulings am Hofe des Maharadscha Siyadschi Rao von Baroda. Einige der Erfahrungen, die ich in den fünf Jahren meines dortigen Aufenthaltes sammeln konnte, werde ich in den folgenden Kapiteln erzählen. Heiteres, Ernstes, Trauriges, Verheißungsvolles und Trübes wird sich in knappen Bildern entrollen; alles aber auf dem Boden ruhiger objektiver Beobachtung, geschärft vielleicht und deutsch beleuchtet von dem sich durch immer wachsende Erfahrung allmählich an das harte, grelle Licht der indischen Sonne gewöhnenden Blicke eines Deutschen.
Zum Verständnis aber der Verhältnisse sollen die folgenden Seiten zunächst auch einen Überblick über die sonderbaren Geschicke der beiden Fürsten selbst geben, mit denen die Laune des Zufalls mich während so langer Jahre in enge Berührung brachte: dem feinsinnigen, stolzen, gewissenhaften Gaekwar von Baroda, Maharadscha Siyadschi Rao, und der phantastischen Gestalt des starrköpfigen, sehr menschlichen Menschen, Dschagatdschit Singh, Maharadscha von Kapurthala.
[S. 16]
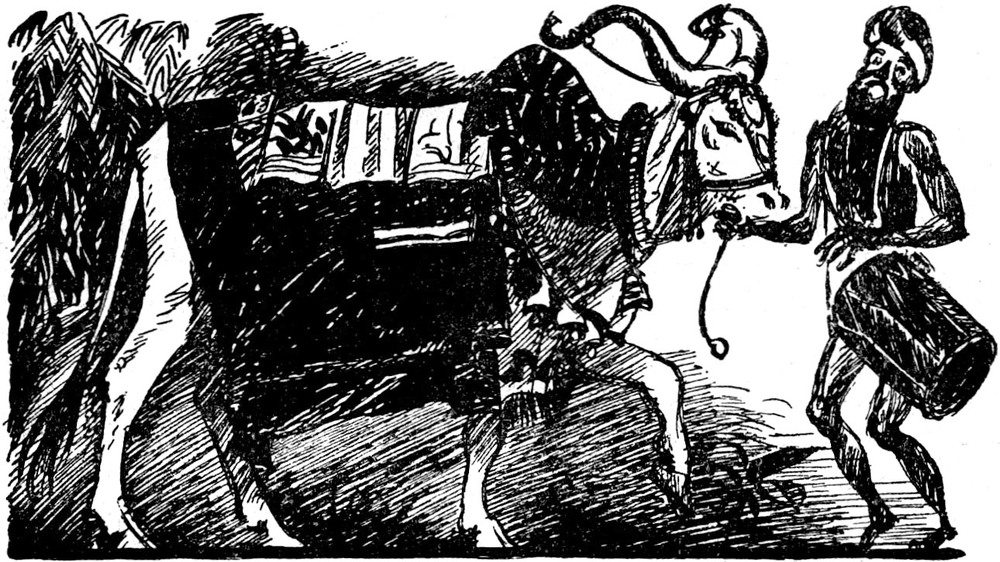
Baroda, zu dessen Fürstenhofe ich damals gehörte, ist unter den fast fünfhundert Vasallenstaaten des britisch-indischen Kaiserreiches einer der größten und wichtigsten. Es liegt an der Westküste Indiens, in der Provinz Gutscherat und wird von den Gaekwari, die zu den in der indischen Geschichte berühmten Maharattenfürsten gehören, beherrscht.
Gaekwar bedeutet „Hüter der Kuh“, und schon der Name weist auf das große Ansehen der Familie hin. Ist doch die Kuh dem Hindu das heiligste aller Tiere, denn von ihrer Milch können Säuglinge genährt werden. Wie schon erwähnt, steht auf das Töten einer Kuh die Todesstrafe. Ihr Fleisch darf kein Hindu anrühren. Sogar Schuhe aus Rindleder darf kein Hindu wissentlich tragen. So sind die „Hüter der Kuh“ die vor allen anderen von den Göttern Auserlesenen. Als besonderer Stamm sind sie[S. 17] über das ganze Land verstreut. Ihrem ehrenvollen Namen entsprechend sind sie fast ausschließlich Viehzüchter und landbesitzende Bauern und Krieger.


Die Maharattendynastie, der die Gaekwari von Baroda angehören, wurde von dem Fürsten Sewagi gegründet, der ein Abkömmling des Radscha von Tschittore war, der ältesten Herrscherfamilie im Westen von Indien. Er legte als Radscha von Satarah den Grundstein des großen Maharattenreiches, das sich unter ihm von Ahmedabad bis nach dem heute portugiesischen Goa, die Westküste Vorderindiens entlang, erstreckte und im Innern an die Reiche der Fürsten von Mysore, von Haiderabad und an die Gebiete des Großmogul grenzte.
Der erste Minister Sewagis war ein Brahmine, der den Rang eines obersten Magistrats bekleidete und als solcher den Titel „Peischwa“ führte. Rang und Titel sind noch heute in vielen indischen Staaten erblich.
Dieser erste Peischwa erhob sich nach Sewagis Tode gegen dessen Sohn, den er im Stammschloß seines Vaters, in Satarah, als Gefangenen hielt und von allen Regierungsgeschäften ausschloß. In der Folge blieb die Herrschaft der Familie der Peischwa als eine Art Brahminen-Priesterherrschaft bis zum Niedergang der Maharatten-Dynastie im Beginn des neunzehnten Jahrhunderts ungestört bestehen.
Einer dieser Peischwa, genannt Bajett Rao, war sogar in dem grausamen Indien durch seine Grausamkeit berüchtigt. Die von ihm am liebsten verhängte Todesstrafe war die „am Bambus“. Es wird dazu eine mit sehr schnell wachsenden, nadelscharfen Sprossen versehene Bambusart gebraucht, auf die der zum Tode Verurteilte so befestigt ist, daß die in einer Nacht um über Fingerlänge treibenden, eisenharten Spitzen der Zweige in qualvoller Langsamkeit, aber unaufhaltsam, seinen Körper durchbohren.
Auch der berühmte Nana Sahib, der Führer des Sipahi-Aufstandes von 1857, entstammte der Peischwa-Familie, unter die alle Fürsten der Maharatten sich beugten, wie der Maharadscha[S. 18] Holkar von Indore, Scindia von Gwalior im Inneren Indiens, der Gaekwar von Baroda, und kleinere, wie der Radscha von Kolapur und einige der Radschputfürsten in der Provinz Kathiawar. Heute sind sie alle Vasallen des britisch-indischen Kaiserreiches, das die Eingeborenen mit „Sirkar“ bezeichnen.
Als 1802 die Ostindische Kompagnie, die „John-Kompagnie“, unter der Leitung des Generals Wellesley, des späteren Herzogs von Wellington, ihre Besitzungen von Kalkutta aus weiter nach Westen auszudehnen suchte, gelang es ihr, in dem damaligen Gaekwar von Baroda einen kräftigen, in den Eigenschaften der Falschheit, Treulosigkeit und Selbstsucht nicht zu übertreffenden Bundesgenossen zu finden.
Gegen das Versprechen der Engländer, ihn als selbständigen Herrscher über die Gebiete, die er für die Peischwa-Familie verwaltete, anzuerkennen, verriet er ihnen seine Maharattenbundesfürsten, den Scindia von Gwalior, den Holkar von Indore und den Radscha von Berar, wodurch der Sturz auch der Brahminenfamilie der Peischwa unvermeidlich wurde. Dieses Abkommen hat England stets auf das genaueste gehalten. Auch heute noch genießt der Staat Baroda viele Privilegien. Er braucht keinen Tribut zu entrichten und kein Truppenkontingent zum Dienste in die anglo-indische Armee zu stellen.
Baroda beteiligte sich auch nicht an dem Aufstande der Sipahi. Es wurde zu jener Zeit von dem charaktervollen, strengen und gerechten Maharadscha Khanda Rao Gaekwar regiert, der als tapfer im Kriege und unerschrocken auf der Jagd bekannt war. Von ihm wird erzählt, daß er den gefährlichen Leoparden und den wilden Eber zu Pferde zu jagen gewöhnt war und vom Sattel aus beide mit dem „Tulwar“, dem krummen Maharattenschwert, zu erlegen vermochte. Nur wer weiß, welche Fertigkeit und Übung dazu gehört, diese Tiere beritten mit der Lanze anzugehen, kann ermessen, wie gewandt und kräftig dieser Gaekwar von Baroda gewesen sein muß.
Als er starb, ohne Kinder zu hinterlassen, folgte ihm sein Neffe,[S. 19] Malar Rao. Grausam, despotisch, habsüchtig, begann er seine Regierung damit, den eigenen Bruder als Staatsgefangenen in einen eisernen Käfig zu sperren, der mitten in der Stadt an einem Wachtturm angebracht wurde. Der Sold der Soldaten wurde einbehalten. Die Gehälter der Beamten wurden nicht ausgezahlt. Dafür stand es beiden Klassen frei, sich durch Bedrückung, durch Raub und Erpressung der Einwohner schadlos zu halten. Wer es wagte, sich bei dem Maharadscha zu beklagen, dem ließ er nicht viel Zeit, diesen voreiligen Schritt zu bereuen.
Selbstverständlich kamen diese Tatsachen sehr schnell auch zu den Ohren des englischen Residenten, der als Vertreter des Vizekönigs jedem bedeutenderen indischen Fürsten zwecks Vermittlung zwischen dem Vasallenstaat und der britisch-indischen Regierung beigegeben wird. Es ist natürlich seine geheime Aufgabe, die Loyalität der Fürsten und ihrer Minister zu überwachen, sowie stets daran zu erinnern, daß der britisch-indischen Regierung das Wohlergehen des ganzen Landes am Herzen liege, und daß sie nicht tatenlos zusehen könne, wenn durch die Schuld der heimischen Verwaltung die Bevölkerung Schaden leide.
Die Stellung eines Residenten ist nicht nur wegen der damit verbundenen Machtfülle unter den englischen Beamten und Offizieren sehr begehrt. Alle diese Posten beziehen ein sehr hohes Einkommen, und stets steht ein fürstlich ausgestattetes, oft schloßartiges Landhaus als Dienstwohnung zu ihrer Verfügung. Die Hauptarbeit liegt im „Augen-offen-halten“. Die einzige Anstrengung ist Sport. Dazu kommt das Ansehen als Vertreter des „Bara-Lord-Sahib“ von Indien, des Vizekönigs, dem die Fähigkeit, bei allen Gelegenheiten eindrucksvoll und überlegen, unerschütterlich und erhaben aufzutreten, Rechnung tragen muß. Jedoch, ein Resident wird umso besser sein, desto geräuschloser und selbstverständlicher er den Fürsten und ihren Ministern stets und immer die absolute Allmacht des britischen Radsch — des britischen Kaiserreiches — einprägen und vor Augen halten kann.
[S. 20]
In vielen Angelegenheiten nun braucht aber jeder indische Fürst die Zustimmung des Vizekönigs, die oft wieder von der Ansicht des Residenten bestimmt wird. Es ist daher nicht verwunderlich, daß die Fürsten sich oft bemühen, ihn durch Geschenke für sich zu gewinnen. Dies erfordert aber einen ganzen Apparat. Zunächst muß ein besonders beredsamer und geschickter Vertrauter, von denen die indischen Fürsten sich meistens mehrere halten und die den Titel „Wakil“ führen, mit dem Haushalte des Residenten Berührung suchen, um dort jemanden zu gewinnen, der, auch wenn er nicht das Ohr des Residenten besitzt, doch in der Lage ist, mit seiner Frau in Verbindung zu treten.
An allen indischen Fürstenhöfen ist es Brauch, der Gemahlin des Residenten tagtäglich durch einen „Jamadar Mali“, einen Obersten der fürstlichen Gärten, mehrere Körbe mit Früchten, Gemüse und Blumen zu übersenden, was als Ausdruck der Ergebenheit des Herrschers gelten soll.
Wenn ein Maharadscha wünscht, die Gattin des Residenten durch ein „Nusser“, ein Geschenk, dazu zu bestimmen, sich zugunsten eines seiner Wünsche bei ihrem Gemahl zu verwenden, so wird zwischen den Früchten des einen Korbes ein Geschenk versteckt, und der zungenfertige Wakil des Fürsten erscheint zur gleichen Zeit wie die Sendung auf der Bildfläche. Mit Hilfe eines Dieners aus dem Haushalte des Residenten, dessen er sich vorher versichert hat, wird dann der betreffende Korb als besonders schön unter großem Wortschwall der Gattin des Residenten gebracht, die nicht so ahnungslos ist, nicht zu wissen, worum es sich handelt. Untersucht sie den Korb in ihrem Zimmer, so findet sie, sei es ein Schmuckstück, sei es einen Leinenbeutel mit Goldmohuren zwischen den Blumen und Früchten.
Sollte der Wakil des Maharadscha zur Rede gestellt werden, so gibt er unverlegen den Zweck des Geschenkes zu und stellt weitere in Aussicht, wenn es nur möglich sei, die Bitte seines Herrn mit einer kleinen Fürsprache bei dem Residenten zu unterstützen. Sonst muß die von dem Wakil gewonnene Vertrauensperson[S. 21] im Hause des Residenten die nötigen Aufklärungen geben, sollte die Herrin nicht selbst schon, wie gewöhnlich, wissen, worum es sich handelt.
Das Versprechen einer Fürsprache verpflichtet einem „damned nigger“, einem „dreckigen Neger“, gegenüber doch zu nichts, und der Erfolg der Fürsprache ist zum Schluß auch nicht die Sache der Geschenkempfängerin, die sich so ohne Gewissensbisse auf Kosten des Fürsten bereichert.
Dieses Spiel versuchte nun auch Malar Rao, als der Resident zu Baroda ihn auf die Folgen der Mißwirtschaft hinwies, die seine Minister sich erlaubten. Eine Beeinflussung des betreffenden Residenten erwies sich aber nicht als durchführbar, schon weil die maßlosen Bedrückungen, die der Maharadscha sich zuschulden kommen ließ, überall bekannt waren, also auch dem Vizekönig zu Ohren kommen mußten. Malar Rao beschwerte sich daher kurzer Hand selbst bei dem Vizekönig und verlangte die Absetzung des Residenten, was die Klugheit der Regierung ohne weiteres bewilligte. Bei seinem Nachfolger wiederholte sich dasselbe Spiel. Wiederum beschwerte sich der Maharadscha und wiederum beeilte sich die anglo-indische Regierung, den Residenten abzurufen, um diesmal einen Offizier, Oberst Phayre mit Namen, an dessen Stelle zu entsenden.
Dieser machte den Maharadscha darauf aufmerksam, daß er entweder zu geordneten Zuständen zurückkehren müsse, oder aber der „Sirkar“ werde die Zügel der Regierung selbst in die Hand nehmen. Auf die erneuten Proteste des Fürsten blieb die Regierung zunächst stumm. Endlich traf eine Mitteilung des Vizekönigs ein, in der dieser den Maharadscha darauf aufmerksam machte, daß der Resident sein vollstes Vertrauen besitze und besonderen Auftrag habe, genaue Berichte über die Verhältnisse in Baroda zu senden.
Dies versetzte Malar Rao in maßlose Wut, die er zuerst an seinen Untertanen ausließ, bis er beschloß, den Residenten zu vergiften. Zu seiner Beseitigung sollte ihm mit seinem Morgentrunk[S. 22] fein geriebener Diamantenstaub gegeben werden. Es ist dies ein absolut sicheres Tötungsmittel; nicht nur kann es nicht geschmeckt werden; es ist auch völlig geruchlos und ist selbst in klarem Wasser nicht erkennbar. Im Innern des Körpers verursacht es unheilbare Entzündungen, die langsam aber sicher zum Tode führen. Ein Diener des Residenten wurde bestochen, den Anschlag auszuführen. Herr Phayre war jedoch nicht umsonst schon lange in Indien gewesen und wußte sehr wohl, welche Gefahren ihn am Hofe des Maharadscha von Baroda umgaben. So genügte eine Unvorsichtigkeit in den Vorbereitungen, die Verschwörung aufzudecken.
Als Malar Rao das Mißlingen seines Anschlages erfuhr, glaubte er, daß auch dem Residenten Geiz und Habsucht das Höchste seien, und sandte ihm drei Ochsenkarren mit Säcken von Rupien, um ihn zum Verschweigen des „unliebsamen Vorfalls“ zu bestimmen. Der Resident aber behielt die Karren, so wie er sie erhalten hatte, als Beweisstück für die Schuld des Maharadscha an dem Verbrechen.
Auf Befehl des Sirkar mußte der Fürst sich nun zunächst auf sein Sommerschloß Makapura zurückziehen, wo er unter strenger Bewachung stand, bis der gegen ihn anhängig gemachte Prozeß entschieden war.
Bei dem noch nie dagewesenen Ereignis verfuhr die englische Regierung mit einer mehr als bedenklichen Loyalität und Gerechtigkeit gegen den Maharadscha Malar Rao, um in ihrer diplomatischen Art jeder unangenehmen Rückwirkung der Behandlung des vornehmen Gaekwar von Baroda auf die anderen Vasallen vorzubeugen. Drei der angesehensten Fürsten, der Maharadscha von Dschaipur, ein Radschput, der von Indore und der von Gwalior, die beide Maharatten waren, wurden vom Vizekönig gebeten, dem Urteil als Schiedsrichter beizuwohnen. Die Verteidigung des Gaekwar wurde den besten Anwälten Indiens und Englands anvertraut, darunter auch dem damals wohl berühmtesten Londoner Rechtsanwalt Sergeant Ballantine.
[S. 23]
Der Mordversuch gegen den Residenten wurde in den Verhandlungen überhaupt nicht erwähnt. Im Urteil wurde Malar Rao der Regierung unfähig befunden, abgesetzt und nach der Provinz Madras verbannt, wo ihm in Arkonum ein Palast und ein bedeutendes Einkommen aus den Steuererträgnissen des Staates Baroda zugebilligt wurden. Seine Minister dagegen wurden nach der Sträflingskolonie auf den abgelegenen Andamaninseln deportiert.
Bemerkenswert ist an dieser Episode die hervorragende Einfühlung der indischen Regierung in die Anschauungen der Vasallenfürsten, die jeden Eingriff in den Rest ihres Scheinkönigtums auf das bitterste empfinden. Um sie nicht zu verletzen, gab die englische Regierung trotz der offensichtlichen Mißwirtschaft in Baroda zweimal dem Ansuchen auf Abberufung ihres Residenten nach. Auch die vollständige Vernachlässigung des Mordanschlages auf Herrn Phayre beruhte auf ähnlichen Erwägungen, da bei einem Verfahren in dieser Angelegenheit der Urteilsspruch nur auf „Tod durch den Strang“ hätte lauten können, dessen Ausführung oder Nichtausführung gleich schwierige Fragen aufgerollt haben würde.
Die Verbannung der Minister nach den Andamaninseln dagegen war für sie eine härtere Strafe als selbst der Tod, ist doch der Inder mit allen Fasern seines Wesens mit dem Lande seiner Geburt verbunden.
Die Frage der Nachfolge des abgesetzten Maharadscha schien zunächst äußerst schwierig, denn Malar Rao hatte weder Kinder noch Verwandte, die man auf seinen Thron hätte setzen können. Trotzdem sah die anglo-indische Regierung klugerweise davon ab, den Staat Baroda den unmittelbaren britischen Besitzungen in Indien einzuverleiben, obgleich die Privilegien Barodas von Malar Rao schamlos zum Nachteile der Landesregierung ausgenutzt worden waren.
Doch die Witwe des verstorbenen Maharadscha Khandao-Rao, die Maharani Dschamnabai, war noch am Leben.
[S. 24]
Zu ihr begab sich der englische Resident von Baroda, um im Namen des Vizekönigs ihren Rat in dieser Frage der Nachfolgerschaft zu hören. Die Unterredung fand in einem Zimmer statt, das durch einen Vorhang in zwei Teile geteilt war, von denen die Maharani den einen benutzte, während der andere für den Residenten bestimmt war. Beide konnten sich so verständigen, doch ohne daß die Maharani sich den Blicken des kastenlosen Europäers auszusetzen brauchte, was sie verunreinigt haben würde.
Im Laufe der durch den Vorhang hindurch geführten Unterhaltung erklärte nun die Maharani dem englischen Residenten, daß sich in Baroda kein geeigneter Anwärter auf den Thron des Gaekwar befinde. Auf ihrer letzten Pilgerfahrt jedoch, nach Dabkar am Flusse Narbuda, habe sie ihr Lager eines Tages in der Nähe einer Semindarfamilie, einer Bauernfamilie, aufgeschlagen, die ebenfalls dem Stamme der Gaekwar angehöre. Von den drei Söhnen dieser Familie habe sie einen zu adoptieren versprochen. Wenn man diese Kinder nach Baroda bringen wolle, so würde sie den auswählen, der Nachfolger des abgesetzten Maharadscha werden solle.
Dieser Ausweg kam der englisch-indischen Regierung sehr gelegen, die auf diese Weise die Möglichkeit erhielt, die Erziehung des Knaben nach ihren Plänen zu gestalten. Daher wurde der Rat der Maharani sogleich angenommen. Noch am selben Tage erhielt der Polizeihauptmann des Distriktes, John Pollen, den Auftrag, die drei Kinder herbeizuschaffen, die er in der Nähe von Dabkar, gemäß ihrem Stande als Gaekwar, als Hütejungen auf der Viehweide fand.
Nach Baroda gebracht und der Maharani vorgeführt, bestimmte sie den mittleren der Knaben zum Nachfolger des Maharadscha Malar Rao. Das Kind war damals etwa 9 Jahre alt; genaue Altersangaben sind in Indien nur sehr selten möglich, da keine Register geführt werden und den einzelnen der Zeitbegriff fehlt. Dieses damals von der Maharani Dschamnabai ausgewählte Kind ist der heutige Gaekwar von Baroda, der Maharadscha[S. 25] Siyadschi Rao, nach dem Nisam von Haiderabad der vornehmste Fürst Indiens.
Sobald die Maharani ihre Wahl getroffen hatte, schritt man dazu, die Ankunft des jungen Maharadscha mit allem Pomp zu feiern. In reiche Gewandung gehüllt, mit Gold und Juwelen geschmückt, hielt Seine Hoheit der junge Gaekwar von Baroda in einer kostbaren „Howdah“ auf dem Rücken des mächtigsten Elefanten der fürstlichen Ställe seinen prunkvollen Einzug in die Hauptstadt seines Landes. Aus dem einfachen Kuhhirten, der noch vor drei Tagen auf der Weide seines Dorfes spielte, war über Nacht einer der reichsten Fürsten des britischen Kaiserreiches Indien geworden.
Und die Maharani hatte klug gewählt. Siyadschi Rao erwies sich als ein eifriger und aufgeweckter Knabe. Er ist heute an Wissen und Bildung einer der höchststehenden Fürsten Indiens, der sein Land zu großem Ansehen gebracht hat. Dem britischen „Sirkar“ ist er wenig zugetan, und die Streitigkeiten nehmen kein Ende, was auch damit zusammenhängen mag, daß viele seiner Besitzungen als Enklaven im britischen Gebiet liegen.
Unter ihm hat Baroda eine erstklassige Universität und viele Schulen erhalten, besonders Gewerbeschulen, wo vor dem Kriege, sehr zum Leidwesen der Engländer, deutsche Lehrer wirkten. Als einziger Fürst Indiens hat er in Baroda den Schulzwang eingeführt. Das Straßen- und Bewässerungswesen ist ausgebaut und eine Eisenbahn angelegt worden. Die Mittel hierzu, ebenso wie die zum Bau des prächtigen „Luxmi Vilas“ fand er bei seiner Thronbesteigung vor. Sir Madava Rao und der englische Resident, die den Staat während seiner Minderjährigkeit geleitet und die Staatseinkünfte verwaltet hatten, waren beide besorgt gewesen, ihm eine gefüllte Schatzkammer zu hinterlassen.
Siyadschi Rao ist sogar gegen die abträglichen Seiten der Landessitten eingeschritten; so ist er gegen die Kinderheiraten vorgegangen und hat die Ausartungen des höheren Kastenwesens bekämpft, obgleich er ein orthodoxer Hindu geblieben ist.[S. 26] Seine Reisen nach Europa und Amerika haben stets seiner Ausbildung und damit seinem Lande gedient. Auch ist er einer der wenigen Fürsten Indiens, der nur eine einzige Gemahlin besitzt und keine Nebenfrauen hält.
Seinen jüngeren Bruder machte er zum „Diwan“, Minister, von Baroda, und der ältere wurde „Senepati“ oder Oberbefehlshaber der Armee.
Wohl besteht die Armee nur aus wenigen Truppenteilen, da der Maharadscha genau weiß, daß er doch nie Krieg wird führen können. Sie ist daher mehr ein Repräsentationsinstrument, für das Siyadschi Rao nicht gern viel Geld ausgibt, da ihm produktive, kulturelle Aufgaben näher am Herzen liegen.
Die berittenen Truppen, genannt „Dschawug Sowar“, dienen vornehmlich zu Eskorten der alten Maharani und der hohen Staatswürdenträger, die alle ständig auf der Straße je nach ihrem Range von einer bestimmten Anzahl solcher Reiter umgeben sind.
Wenn die Maharani, umringt von vierzig, fünfzig dieser Krieger, angefahren kommt, so ist das wirkliches, von Europa unberührtes, altes Indien. Wohl vor tausend Jahren mögen die gleichen Waffen, die gleiche Kleidung von Reitern getragen worden sein, die in gleichen Sätteln in derselben Weise die Wagen der Maharani jener Tage in wilder Jagd umschwärmten. Vorn der „Killadaur“, der Oberst, dem ein Paukenschläger folgt, der seinen „Nagara“ mit hageldichten Schlägen das lauteste an Tönen entlockt, was menschliche Ohren noch ertragen können, und daneben ein Trompeter, der aus einer Art Waldhorn ein Geräusch hervorzaubert, das jenseits aller Möglichkeiten europäischer Musikbegriffe liegt. Und neben dem Wagen reitet ein Herold, der mit gewaltiger Stimme die Pauken und die Trompete zu überbieten sucht, um all und jedem den Namen und die Tugenden der Insassin der Karosse zu verkünden. —
Die Artillerie Siyadschi Raos ist ein Teil der „Toscha Kana“, der Schatzkammer, denn sie besteht nur aus zwei massiv goldenen[S. 27] und zwei ebensolchen silbernen Kanonen, die als prunkvolle Erbstücke den Stolz der ganzen Einwohnerschaft bilden, wie überhaupt jede indische Bevölkerung den Glanz und die Prachtentfaltung ihres Herrschers mit Genugtuung als ihre eigene Ehre und Würde erhöhend empfindet und in dem Maharadscha den sichtbaren Ausdruck ihrer eigenen Macht erblickt. Eine wundervolle Sammlung von Smaragden und Diamanten, von denen der berühmte „Südstern“ nur bei großen Staatshandlungen von dem Gaekwar angelegt wird, bildet wie an allen indischen Fürstenhöfen auch in der Schatzkammer zu Baroda den Kern der Kostbarkeiten, unter denen hier aber als ein wohl auf Erden einzigartiges Schmuckstück ein Vorhang hervorgehoben zu werden verdient, der zwei Meter hoch und anderthalb Meter breit vollständig aus dichtaufgereihten Perlen besteht.
So ist der Maharadscha Siyadschi Rao, Gaekwar von Baroda, wohl einer der mächtigsten Vasallen des indischen Kaiserreiches — doch eben nur Vasall, Höriger einer höheren Gewalt, der er nichts als seinen Stolz und sein Selbstbewußtsein entgegenzusetzen vermag. Immerhin, auch die Macht der anglo-indischen Regierung muß mit den Verhältnissen rechnen, so wie sie dies bei Malar Raos Missetaten tat, mit der Meinung von vielen Millionen Menschen, eingeteilt in hunderte von kleineren und größeren Staaten, mit den Anschauungen der vielen verschiedenen Religionsgemeinschaften, die in der Zahl ihrer Anhänger und deren fast bedingungslosem Gehorsam jederzeit zu einer Gefahr werden können, der nur durch kostspielige Veranstaltungen politischer und militärischer Art zu begegnen ist. Und Indien soll doch nichts kosten, sondern vor allen Dingen Geld in den englischen Beutel bringen!
Für beide Tatsachen, die Hörigkeit der Vasallen und die Zurückhaltung der anglo-indischen Regierung, sind die folgenden Tatsachen bezeichnend:
Als der spätere Zar Nikolaus II., derselbe, der mit seiner ganzen Familie in Jekaterinburg durch die Bolschewisten ermordet[S. 28] worden ist, als Thronfolger, zusammen mit dem späteren König von Griechenland, auf seiner Weltreise Indien besuchte, wurde auch der Gaekwar von Baroda zur Ehre, ihn bewirten zu dürfen, befohlen. Doch die anglo-indische Regierung war eifrig bemüht, den russischen Thronfolger von jeder Berührung mit den einheimischen Fürsten fern zu halten. Folglich legte man auch dem Maharadscha Siyadschi Rao nahe, daß er wohl die Kosten des Besuches tragen dürfe, aber davon Abstand nehmen möge, Seine Kaiserliche Hoheit zu sehen. Der Gaekwar fügte sich und wurde rechtzeitig krank.
Trotzdem aber führte man den russischen Thronfolger nicht in die Stadt, sondern auf die vorbereitete Jagd. Ich hatte das große Empfangszelt aus der „Faraschkana“, der Jagdkammer, in aller Eile aufstellen lassen, wozu hunderte von Dienern notwendig waren.
Etwas ängstlich erschien endlich der Zarewitsch mit seinem russischen und englischen Gefolge und nahm ohne besondere Begeisterung an der Jagd, einem Lanzenreiten gegen Wildschweine, „pigsticking“, teil. Nach etwa einer Stunde wünschte er zurückzukehren, und ich, der ich die Verantwortung für die ganze Vorführung trug, ritt allein mit ihm nach dem Empfangszelt, ohne daß die englischen Beamten, darunter Oberst Cyrill Rhodes, der Bruder des Rhodesiers, Cecil Rhodes, dies bemerkten. Froh, der ihm wenig zusagenden Jagd entronnen zu sein, saß der Zarewitsch mit mir im Zelte und trank Moselwein mit Apollinaris. Zuerst unterhielt er sich mit mir auf englisch, fuhr dann französisch fort, um zum Schluß fließend deutsch zu sprechen.
Als die englischen Herren mich bei ihrer Rückkehr in vertraulichem Gespräch mit dem gefährlichen Besucher sahen, machten sie entgeisterte Gesichter und bestürmten mich mit bestürzten Fragen, was denn zwischen uns besprochen worden sei? Ihr ganzes Benehmen gegen den harmlosen Prinzen war einfach lächerlich, taten sie doch, als ob dieser unschuldigste und unwissendste unter allen Fürstlichkeiten, mit denen ich jemals zusammengekommen[S. 29] bin, sich auf einem Raubzuge gegen das britisch-indische Kaiserreich befände!
Nur die Vasallen wurden ihm vorgestellt, deren Loyalität außer allem Zweifel stand, und von ihnen auch nur die, welche der englischen Sprache nicht mächtig waren. Die Nordwest-Provinzen — am oberen Ganges und Indus bis nach Kaschmir — ließ man ihn überhaupt nicht betreten, und, wie erwähnt, sein Gastgeber in Baroda, der Maharadscha Siyadschi Rao, mußte während seines Besuches sich krank stellen.
Wie sehr dieser Zwang des Gehorchens, unter dem der Gaekwar trotz aller Selbständigkeit im Innern seines Staates gegenüber der anglo-indischen Regierung lebt, seinen Stolz bedrückt und verletzt, zeigte er in einer Unterhaltung mit dem Maharadscha von Kapurthala, der ich beiwohnte.
Es war im Frühjahr 1905, und ich befand mich mit dem letztgenannten Fürsten, dessen Privatsekretär ich in der Zwischenzeit geworden war, in Paris, wo wir im Hotel Jena mit Siyadschi Rao zusammentrafen. In jenem Jahre sollte der Prinz von Wales, der spätere König Georg IV., Indien besuchen. Als die Unterhaltung hierauf kam, sprach der Gaekwar von Baroda ganz offen aus, daß er, um nicht mit diesem Herrn zusammentreffen zu müssen, bis nach dem Besuche des englischen Prinzen in Indien in Europa bleiben würde, denn er habe keine Lust, Staatsgelder auszugeben, um die Ehre zu haben, sich vor dem zukünftigen englischen Herrscher zu verbeugen. Da man ihn als Gastgeber des russischen Thronfolgers, der seinen Gast nicht einmal sehen durfte, lächerlich gemacht habe, werde er es jetzt ablehnen, den britischen Thronfolger bei sich zu empfangen.
Doch nicht nur im sicheren Paris machte Siyadschi Rao kein Hehl aus seiner Abneigung gegen die Engländer. Auch in Indien selbst ließ er keine Gelegenheit vorübergehen, den englischen Beamten seine Bildung, besonders in allen Fragen der Staatsverwaltung, fühlen zu lassen. Von seiner Erziehung unter guten englischen Lehrern hatte er eifrig Gebrauch gemacht, und auf[S. 30] der so erworbenen Grundlage war er nach Erreichung seiner Volljährigkeit mit Erfolg weitergeschritten, so daß er über eine erstaunliche, rein wissenschaftliche Bildung verfügte. Daher konnte es nicht ausbleiben, daß er sehr schnell das oft recht minderwertige und unvollständige Wissen auch der hohen anglo-indischen Beamten durchschaute. Seine Achtung vor dem britischen Löwen wurde dadurch nicht gesteigert, und als Lord Curzon zur Zeit der Thronbesteigung des Königs Eduard VII. diesen in Delhi vertrat und zu Ehren des Ereignisses ein großes Fest gab, weigerte er sich, zu erscheinen, indem er Krankheit vorschützte.
Dies war ihm jedoch nicht möglich, als nach dem Tode Eduards VII. Georg IV. in höchsteigener Person nach Indien kam, um dort sich und seine Gemahlin zu Kaiser und Kaiserin von „Hind“ — von Indien — krönen zu lassen.
Angetan mit allen Zeichen der Macht, umringt von sämtlichen Würdenträgern des britischen Hofes, hatten Georg IV. und seine Gemahlin auf dem kaiserlichen „Gadi“ — Thron —, zu dem eine Reihe Stufen hinaufführten, Platz genommen. In dem mit echt indisch-englischer Pracht ausgestatteten Raum war Jeder und Jede der Anwesenden auf das reichste gekleidet. Gold, Diamanten, die seltensten Edelsteine blitzten und funkelten auf allen Seiten. Die Uniformen der Offiziere und Höflinge bildeten einen leuchtenden Rahmen, in dem der Glanz aller indischen Fürstenhöfe nur um so eindrucksvoller strahlte.
Inmitten dieser prunkvollen Versammlung nun sollte die Huldigung der Vasallenfürsten mit allem Zeremoniell des Westens und des Ostens vor sich gehen. Es war vorgeschrieben, daß die Fürsten im Schmucke ihrer Staatsgewänder sich über die freie Mitte des Raumes den Stufen des kaiserlichen Thrones nahen sollten. Zur Plattform vor den Sesseln des Kaiserpaares hinaufsteigend, würden sie sich dann als Ausdruck der Ergebenheit verbeugen, um, rückwärts schreitend, die Thronstufen hinabzugehen, wo ein Adjutant des Königs ihnen das Zeichen zum Umwenden und Weitergehen zu geben hatte.
[S. 31]
Als Erster erschien der im Range am höchsten stehende Nisam von Haiderabad, ein mohamedanischer Fürst, der die übereingekommene Huldigungsform mit der ganzen Würde des Moslem erfüllte. Ihm folgte sofort der Gaekwar von Baroda, der Maharadscha Siyadschi Rao.
Ein Murmeln des Entsetzens lief bei seinem Erscheinen durch die erlauchte Versammlung. Eiligen Schrittes, einen Spazierstock nachlässig in der Hand schwingend, kam er auf die Stufen des Thrones zu, sprang sie schnell hinauf, nickte dem Kaiser und König des britischen Weltreiches kaum merklich zu, und, ihm sofort den Rücken kehrend, ging er hastig und wie mit ganz anderen Gedanken beschäftigt die teppichbelegten Stufen wieder hinab, an dem starr und ratlos stehenden königlichen Adjutanten vorbei, und verließ den Raum.
Daß ihm diese öffentliche, beabsichtigte Brüskierung Seiner Majestät des Kaisers von Indien und Königs von Großbritannien und Irland seinen Thron kosten konnte, wußte der Sohn des Bauern von Dabkar sehr wohl. Doch der britische Sirkar übersah die dem Kaiser und König angetane Schmach. Die Zeit war zu nahe, wo man Indien nötig brauchen würde, wo man keinen Mann würde entbehren können, um den dreihundert Millionen seiner Bewohner die Macht des britischen Reiches besonders vor Augen zu führen! Ist doch der Weltkrieg, nach englischer Darstellung, einzig und allein vom frevelhaften Übermut des bösen deutschen Kaisers plötzlich und grundlos dem armen unschuldigen England und der ebenso ahnungslosen übrigen Welt aufgezwungen worden!
Dem Maharadscha Siyadschi Rao, Gaekwar von Baroda, ist daher aus seinem wenig höflichen Benehmen auf dem Durbar zu Delhi 1912 kein irgendwie bemerkenswerter Schaden erwachsen[1]. Sofort nach Verlassen des Krönungsraumes war er in sein Land zurückgefahren.
[S. 32]

Der Maharadscha von Kapurthala, in dessen Dienst ich nach Ablauf meines Vertrages mit dem Gaekwar von Baroda als Aufsichtsbeamter über alle Paläste, Marställe und Gestüte, sowie als Privatsekretär für seinen persönlichen Verkehr mit Europäern trat, war das ganze Gegenstück zu Siyadschi Rao, obgleich auch er nur durch einen Zufall auf den Thron seines Reiches gelangt war.
Sein voller Titel lautet: Sir Dschagatdschid Singh, Bahadur, Ahluwalia, Radscha-i-Radschan, Großkommandeur des Sterns von Indien, Maharadscha von Kapurthala; es bedeuten die indischen Worte etwa: Oberkriegsherr, aus dem Geschlecht der Ahluwalia, Fürst der Fürsten, Oberherrscher von Kapurthala.



Der indische Vasallenstaat Kapurthala liegt in der Nähe von Lahaur, dem englischen Lahore. Lahaur war früher die Hauptstadt[S. 33] der kriegerischen Sikh. Auch die mohamedanischen Eroberer Nord-Indiens schlugen dort ihre Residenz auf, erst die Ghasnawiden, denen die Goriden folgten, bis es 1225 von Dschalal-ud-Din und 1397 von einem Heerführer Tamerlans, des großen Timur leng der Mongolen, geplündert wurde. 1525 nahm es Sultan Babar, seit welcher Zeit es zum Reiche des Großmogul gehörte und an Pracht und Glanz mit der Hauptstadt Nord-Indiens, mit Delhi, wetteiferte. 1846 besetzten die Engländer Stadt und Land, bemächtigten sich des letzten Sikhfürsten, Dalip Singh, eines elfjährigen Knaben, den sie nach England führten, wo er nach verschiedenen fehlgeschlagenen Versuchen, den Thron der Sikh wieder zu besteigen, 1893 starb.
Schon einige Jahre vor der Besitzergreifung Lahaurs durch die Engländer hatten sie, 1841, Hand auf das Zweistromland Dschalandhar gelegt, das den Staat Kapurthala umfaßt. Die dort herrschende Ahaluwalia-Dynastie hatte es vorgezogen, durch eine Tributzahlung an die Engländer sich ihren Besitz zu sichern, wenn auch die Briten die Verwaltung übernahmen. Bei dem großen indischen Aufstand 1857/58 unterstützte der damalige Maharadscha von Kapurthala, Ranghir Singh, die Engländer, wofür er durch die Übertragung großer Ländereien in Oudh[2] belohnt wurde. Ihm folgte 1870 sein Sohn Karag Singh.
Der Staat Kapurthala zählte etwa eine halbe Million Einwohner, während die in der Nähe der Bahnstation Kartarpur liegende Hauptstadt Kapurthala rund 20000 Einwohner hat.
Karag Singh führte ein allen Leidenschaften frönendes Dasein; viel Sekt, viel Kognak, viel Opium sind besonders in dem heißen Indien nicht geeignet, das Leben zu verlängern. Er kam also in jungen Jahren zum Sterben. Da er keine Kinder hatte, war der nächste Erbberechtigte sein Bruder, Harnam Singh. Doch[S. 34] Harnam Singh hatte eine indische Christin geheiratet und war selbst zum Christentum übergetreten.
Die, wenn es das Geschäft mit sich bringt, so gern ihr Christentum betonenden Engländer fanden es aber in diesem Falle nicht einträglich genug, „the spreading of the Gospel of our Lord and Saviour Jesus Christ“ — die Ausbreitung des Evangeliums unseres Herrn und Erlösers Jesus Christus —, wie die pomphafte Redewendung im Englischen heißt, dadurch zu unterstützen, daß sie einem Christen die Besteigung des ihm rechtmäßig zustehenden Thrones eines indischen Fürstentums gestatteten.
Man beriet sich also mit dem Ministerpräsidenten des Staates Kapurthala, der ein offenes Herz für seine Hindu-Glaubensgenossen und sicherlich eine nicht minder offene Hand für christliche englische Goldstücke hatte, mit dem Ergebnis, daß, ehe noch der sterbende Maharadscha Karag Singh seine letzte Opiumpfeife zu Ende geraucht hatte, ihm plötzlich ein Sohn geboren war. Bevor er den vielen Freuden seines Genußlebens das Bewußtsein von Vaterfreuden zufügen konnte, drehte er sein Antlitz zur Wand und starb.
Der zu so geeigneter Zeit geborene Thronfolger war das Kind des Steueraufsehers Lala Harkischen Lal aus der Kaste der Tschatry[3]. Unter dem Namen Dschagatdschit Singh wurde er der Nachfolger seines Pseudo-Vaters, des Maharadscha Karag Singh. Der wegen seines Christentums von den Engländern von der Thronfolge ausgeschlossene Harnam Singh wurde, zum Trost über den erlittenen Verlust, zum Mitgliede des vizeköniglichen Staatsrates in Kalkutta ernannt.
Die Erziehung des jungen Dschagatdschit Singh lag vollständig in den Händen des englischen Residenten, und er entwickelte sich ganz nach dem Vorbilde seines Lehrers. Dieser Resident, ein[S. 35] Irländer von Geburt, großer Sportliebhaber und Lebemann, verbrachte seine Zeit mit Festlichkeiten, Jagden, sportlichen Veranstaltungen und glänzender Repräsentation, ohne daß die Verwaltung des Landes Schaden litt. Es wurde sparsam und umsichtig gewirtschaftet, und der Resident verstand sich meisterhaft auf die Behandlung der schwierigen indischen Charaktere.
Doch durch die ausschließliche Erziehung im englischen Sinne wurde in dem jungen Maharadscha schon früh der Keim zu seiner Vorliebe für alles Europäische, alles Westliche gelegt. Dschagatdschit Singh war, wie die meisten Inder, äußerst begabt, dabei ein offener und gutherziger Mensch, was unter Indern eine große Seltenheit ist, aber vielleicht auch auf Rechnung seiner Erziehung gesetzt werden darf. Er besaß ein unerschütterliches seelisches Gleichgewicht, das ihn auch in den unangenehmsten Augenblicken nicht verließ. Gegen seine Untergebenen war er herablassend und freundlich, konnte aber ebenso bei Verfehlungen sehr streng sein. Höchstens, daß er dazu neigte, die Grenzen zwischen rücksichtsvoller Teilnahme und kameradschaftlicher Anbiederung zu vergessen.
Von Gestalt ein starker, wuchtiger Mann, verstand er es ausgezeichnet, sich in der ganzen Würde eines indischen Fürsten zu geben. Er neigte zur Korpulenz, trotzdem er als Tennisspieler und Scharfschütze seinesgleichen suchte. Nur das Reiten, das er, wie es seine Stellung erforderte, wenigstens zweimal in der Woche ausüben mußte, machte ihm kein Vergnügen. Bei seinem kräftigen Körperbau war dies auch nicht verwunderlich. Es kostete mich stets die größte Mühe, für den schweren und im Sattel unbeholfenen Mann ein entsprechend starkes und doch ruhiges, repräsentatives Pferd zu finden. Glücklicherweise war die Auswahl in den prachtvollen Marställen des Fürsten groß, und in Einkauf und Aufzucht wurde mir vollständig freie Hand gelassen. Für den Maharadscha war das fetteste Pferd das schönste.
Im Trinken war er sehr mäßig. Sekt, Wein und Alkohol im allgemeinen, obgleich er seinem Körper entsprechend davon trank,[S. 36] hatten keine Anziehungskraft für ihn. Dafür aber war er einer der stärksten Esser, der mir je begegnet ist. Besonders von seinem und ganz Indiens Leibgericht „Curry mit Reis“ konnte er ganz außerordentliche Mengen vertilgen.
Doch er hatte eine große Schwäche, eine Schwäche, die, von seiner Erziehung genährt, wohl ebenfalls mit der starken physischen Entwicklung seines Körpers zusammenhing und in seinem westlich gerichteten Ehrgeiz ihn zu den unglaublichsten Streichen verführte. Er hielt sich für den geborenen „Lady-killer“, den hervorragendsten Don Juan beider Hemisphären. Keine noch so bittere Enttäuschung, keine Lächerlichkeit konnte ihm diesen Glauben rauben. Stets strebte er nach neuen Lorbeeren, aber sie mußten westlich orientiert sein, oder noch besser, durch westliche, europäische Schönheiten ihm zufallen.
Blutige Schweißtropfen hat mich oft diese unmögliche Einbildung gekostet. Immer wieder mußte ich die zerbrochenen Porzellanschalen umsichtig und geräuschlos außer Sicht kehren, immer von neuem die gordischen Knoten, die seine Abenteuer um ihn schürzten, mit oder ohne Hilfe des neuzeitlichen Schwertes, des Scheckbuches, lösen.
Den Auftakt zu dieser endlosen Kette seiner vor allen Dingen ehrgeizigen Unternehmungen bildete seine Heirat. Als Dschagatdschit Singh neunzehn Jahre alt war und die Regierung selbst übernehmen sollte, wurde beschlossen, mit der Thronbesteigung die Hochzeit des jungen Fürsten zu verbinden. Gegen die in Indien übliche Kinderheirat hatte der Resident Einspruch erhoben, und man suchte nun nach einem Mädchen, das der hohen Ehre, die Maharani von Kapurthala zu werden, würdig war. Als regierender und reicher Maharadscha konnte man ihm eine Frau aus einer höheren Kaste als seiner eigenen verschaffen[4]. Die[S. 37] Wahl fiel auf ein Mädchen aus einer der hochangesehenen Radschputfamilien, die im Kulu-Tal des Himalaja ansässig war, und dessen Vater nicht die Mittel gehabt hatte, seine vier Töchter noch in jungen Jahren entsprechend zu verheiraten. Die Hochzeit wurde mit dem üblichen Pomp im Beisein einer großen Menge von Gästen aus der hohen anglo-indischen Gesellschaft gefeiert, und der junge Maharadscha lebte, beraten und geführt von seinem englischen Residenten, zwischen den indischen Gebräuchen und Sitten im Innern seines Palastes, den Zenanagemächern seines Haushaltes und den freien Vergnügungen seiner englischen Freunde, welche die mit dem Reichtum des Fürsten verbundenen Annehmlichkeiten wohl zu schätzen wußten.
Doch die Erzählungen seiner europäischen Umgebung, die Beschreibungen der durchreisenden Weltbummler, die gern an dem gastlichen Hofe von Kapurthala haltmachten, steigerten immer mehr seinen Wunsch, die Wunderländer Europas und Amerikas kennenzulernen und in den glänzenden Städten des Westens, in Paris und London, eine seinem Ehrgeiz entsprechende Rolle zu spielen. Mit großem Eifer lernte Dschagatdschit Singh aus eigenem Antriebe sowohl Englisch wie Französisch und war bald imstande, sprachbegabt wie es alle Inder sind, sich in beiden Sprachen mit absoluter Vollkommenheit auszudrücken.
Als er diese Vorstufe zu seinen Reiseplänen hinter sich hatte, beschäftigte er sich mit den Einzelheiten ihrer Ausführung. Sein Wunsch war, daß die Maharani, die ihm in der Zwischenzeit einen Sohn geschenkt hatte, ihn begleite. Sie aber hielt mit starrem Eigensinn an den alten Sitten und Gebräuchen ihrer eigenen Kaste fest, die es ihr unbedingt verboten, mit kastenlosen Europäern, die sich ohne jede Rücksicht auf den Stand ihrer Diener einfach und wahllos von ihnen bedienen lassen, in enge[S. 38] Berührung zu kommen, mit fremden, unbekannten Menschen das große Meer zu kreuzen und Indien zu verlassen. Wer sollte ihr die Speisen bereiten? Wie sollte man sicher sein, daß nicht Unreines mit ihnen in Berührung gekommen war? Wie sollte man es vermeiden, inmitten der ungebildeten Bevölkerung Europas, durch ihre Nähe, ihr Anstarren, ihre Handreichungen beschmutzt zu werden? Wo sollte man die Zeit und das heilige Wasser hernehmen, um durch religiöse Waschungen sich wieder von so viel Unrat zu reinigen? Nein, die Maharani konnte unmöglich sich solchen Gefahren aussetzen. Sie blieb unter allen Umständen in Indien.
Vor der Hand schickte sich Dschagatdschit Singh in Geduld ... und lernte Tanzen. Daß er damit die Entrüstung selbst der liberalsten Hindu erregte, kümmerte ihn nicht weiter.
Für den Hindu, wie überhaupt den Orientalen, ist das Zusammentanzen der Geschlechter ein Greuel. Tanzen ist eine bezahlte Kunstfertigkeit, die von dazu erzogenen Mädchen, den „Nautsch-Mädchen“, den Bajaderen gegen Entgelt ausgeübt wird. Daß diese es dabei zu großem Reichtum bringen können, und daß sie ganz allgemein große Achtung und besondere Vorrechte genießen, hat mit dem Tanzen an sich nichts zu tun. Von einem Manne zum Vergnügen und unter den Augen anderer ausgeübt, wird es dadurch nicht weniger verächtlich.
Doch da die Maharani auf ihrer Weigerung beharrte, ihn nach Europa zu begleiten, nahm der Maharadscha kurz hintereinander drei andere Frauen, die er zu seinen „Rani“ machte. Der Titel „Maharani“ kommt nur der ersten Frau und Mutter des Thronfolgers zu. Doch sie alle enttäuschten. Keine der drei wollte sich herbeilassen, europäische Sitten anzunehmen und vor allem auch noch so glänzende Pariser Toiletten oder gar die europäischen Spitzen und Unterkleidung zu tragen, für die der Maharadscha eine ganz ausgesprochene Vorliebe und Bewunderung an den Tag legte. Alle fürchteten, die Heiligkeit ihrer Kaste dadurch zu verletzen.
[S. 39]

Und doch, ohne „Rani“ nach Europa zu gehen, schien dem Maharadscha ebenfalls unmöglich. Nach allen Seiten sandte er Beauftragte, um ihm die zu suchen, die seinen Enthusiasmus für Europa zu teilen und gleich ihm alles Indische abzustreifen bereit war. Jedoch vergeblich. Endlich entschloß er sich, sein Glück selbst zu versuchen und nach einer geeigneten Rani Umschau zu halten.
Dschagatdschit Singh hatte die Erlaubnis des Vizekönigs erhalten, auf vierzehn Tage das ihm selbst in Simla, dem Sommersitz der anglo-indischen Regierung im Himalaja, gehörende Haus bewohnen zu dürfen. Der Aufenthalt dort ist aus Gründen der Rücksicht auf die Engländer Indiens für die Fürsten Indiens beschränkt. Sie vermehren durch den endlosen Troß ihrer Bedienung die sehr fühlbare Wohnungsnot dieser für die Gesundheit[S. 40] der Beamten unentbehrlichen Bergfrische und treiben durch protzenhafte Verschwendung die Preise in die Höhe. Es muß also jedesmal eine besondere Erlaubnis zum Besuche des Ortes erwirkt werden. Nur ausgewählte Günstlinge der Regierung, wie der Scindia von Gwalior oder das Haupt der Radschputen, der Maharadscha von Bikanir, die zu persönlichen Adjutanten des Königs von England und Kaisers von Indien ernannt worden sind, dürfen jederzeit den geheiligten Boden betreten.
Unweit von Simla findet alljährlich ein großer Markt, „Sibi-Markt“, statt, wohin Eltern ihre unverheirateten Töchter bringen, um sie heiratslustigen Männern zur Wahl vorzustellen. Es ist dies keineswegs entehrend. Achtbare Bauernfamilien, Semindare, Landbesitzer und höhere Kasten machen von dieser Gelegenheit, ihre unversorgten Töchter zu verheiraten, Gebrauch. Witwer oder kinderlose Ehemänner suchen sich dort eine neue Gattin zu kaufen. Zwar stimmen die so an den Mann gebrachten Mädchen nicht immer mit dem von den Eltern abgeschlossenen Handel überein, sei es, daß dem Mädchen der Käufer zu alt oder sonst nicht annehmbar erscheint. In solchem Falle verflüchtigen sie sich noch vor der festgesetzten Abreise. Der Bräutigam hat das Nachsehen und ist sein Geld an die Eltern losgeworden. Allzu bindend sind diese Kontrakte nicht, die von den Gerichtshöfen nicht ernst genommen werden.
Der Maharadscha von Kapurthala benutzte nun den Aufenthalt in Simla, um den Sibi-Heiratsmarkt zu besuchen. Dort sah er ein junges, sechzehnjähriges Mädchen, schlank, mit klugem Gesicht, in der Hautfarbe nicht dunkler als eine Italienerin; denn dies war für Dschagatdschit Singh die Hauptsache. Er selbst war zwar braun wie eine Ratte, hielt aber seine Gesichtsfarbe für rosig. Für diese Vorliebe hatte er gute Gründe. Die Verachtung der Engländer für „niggers“ gibt sich überall im Osten und in Australien in der auffälligsten und beleidigendsten Weise kund, und wird natürlich stets zunächst von der Gesichtsfarbe des Betreffenden ausgelöst. Es ist daher nicht verwunderlich,[S. 41] daß der Maharadscha in seinem Bestreben, möglichst europäisch zu wirken, auf recht hellen Teint größtes Gewicht legte. Das junge Mädchen, das Kanari hieß, wurde nun für die Summe von dreihundert Rupien oder etwa 450 damaligen Mark sein Eigentum. Unter der Etikette einer Kammerzofe der Maharani kam sie nach Kapurthala. Es dauerte nicht lange, und sie hatte die Lage vollkommen verstanden, fanden sich doch genügend Leute, sie über die Anschauungen und Absichten des Maharadscha aufzuklären.
Doch noch zögerte Dschagatdschit Singh, den entscheidenden Schritt zu tun. Zwar war auch ihm nicht unbekannt, daß Kanari bereit war, ihm in seinen europäischen Ansichten bis zur Grenze des Möglichen entgegenzukommen. Aber der Schritt, in so ausgesprochener Weise mit allen Anschauungen seiner Umgebung zu brechen, bereitete ihm doch noch Kopfzerbrechen. Da entschied ein indisch-ehelicher Zwischenfall über die Zukunft des klugen Mädchens.
Der Hof von Kapurthala war nach Dharamsala im Gebirge übergesiedelt, und dort überraschte der Maharadscha eines Tages die Rani Luxmi, seine zweite Frau, beim vertrautesten Zusammensein mit einem seiner Kammerdiener. Dieser Schlag traf den unwiderstehlichen Don Juan an seiner empfindlichsten Stelle. Er verlor sein sonst so ausgeprägtes Gleichgewicht, seine stoische Ruhe. Mit eigener Hand verprügelte er den Diener, und fast hätte er sich auch an der Rani Luxmi vergriffen.
Dieser Vorfall bewirkte, daß er nicht länger zögerte, Kanari zu seiner Rani zu machen. Nach Kapurthala zurückgekehrt, vollzog er unter großen Festlichkeiten die Erhebung des schönen Mädchens zu seiner fünften Gemahlin und Lieblingsfrau. Die Zenanaräume, in denen die Frauen des Maharadscha wohnten, lagen im zweiten Stock des Palastes, wo nun auch Rani Kanari ihre Zimmer erhielt. Bis zu ihrer Ankunft hatten die Damen es stets für unvereinbar mit ihrer Würde als Radschputen gehalten, mit dem Maharadscha, der aus einer niederen Kaste stammte, zusammen zu speisen. Denn wenn sie auch nichts dagegen[S. 42] hatten, seine Frauen zu sein, so ist die Zeremonie des Essens doch von bedeutend größerer Wichtigkeit. Als sie aber gewahr wurden, daß die Rani Kanari keinen Anstoß nahm, mit dem Maharadscha sogar auf europäische Weise zu Tisch zu sitzen, ließen sie sich herbei, den Maharadscha einmal wöchentlich zu ihren gemeinsamen Mahlzeiten zu bitten; vielleicht auch, um über der neuen Gemahlin nicht ganz vergessen zu werden.
Eine Gouvernante mußte der Rani Kanari französischen Unterricht erteilen. Die blendendsten Kleider, die prächtigste Unterwäsche traf für sie aus Paris ein, die ihrer schlanken, biegsamen Gestalt entzückend standen. Schon träumte der Maharadscha davon, die große Welt Europas zu den Füßen seiner Rani liegen zu sehen. Sie sollte Weltdame in höchster Vollendung werden, und sein Ehrgeiz war, zu zeigen, daß eine reine Inderin es fast in jeder Hinsicht mit den Damen der europäischen Völker aufzunehmen vermöge.
So anerkennenswert auch dieses Bestreben unter gewissen Gesichtspunkten sein mag, und so gut sich auch die von ihrer Heimat im Gebirge her nicht so kastenstreng und orthodox erzogene Rani Kanari dazu eignete, eins übersah Dschagatdschit Singh und mußte es übersehen — denn Psychologie war ihm von seinen englischen Lehrern nicht ausreichend nahe gebracht worden. Der gegenüber seiner eigenen robusten Natur feiner und reizbarer geschaffene Organismus des jungen Mädchens verfiel viel zu schnell den Einflüssen europäischer Genußmittel. Die Anregung, die Weine, Sekt und Liköre auf sie ausübten, wurde ihr bald zum Bedürfnis, und sie fand nur zu viele Helfer, die ihr bereitwillig auch in ihre Gemächer Kognak und ähnliche starke Spirituosen zusteckten.
Dem Maharadscha, dem dies nicht verborgen blieb, ging diese Neigung des schönen, jungen Mädchens sehr nahe, war er doch selbst bei aller Wertschätzung, die er einem Glase Wein oder Champagner entgegenbrachte, stets mäßig geblieben. Er hoffte, daß die so lange geplante Reise nach Europa, die er nun bald[S. 43] anzutreten beabsichtigte, die Rani Kanari von ihrer fatalen Angewohnheit heilen würde.
Solche Reisen der Vasallenfürsten Indiens unterliegen aber der Genehmigung der anglo-indischen Regierung, die in jedem einzelnen Falle besonders eingeholt werden muß. Im Prinzip besteht eine starke Abneigung, die Erlaubnis zu erteilen, was seine guten Gründe hat. Es hat sich stets gezeigt, daß die Behandlung, die in Europa den indischen Fürsten zuteil wird, nur zu geeignet ist, ihr Selbstbewußtsein zu stärken. Nicht nur behandelt man sie dort ganz allgemein als gleichberechtigt, wirbt um ihre Gunst als Kunden und Gäste und ergeht sich in Ehrenbezeugungen, sondern in London wurden Maharadschas als Ehrengäste an der königlichen Tafel empfangen; auf Dampfern und in den Bahnzügen konnten sie sich die besten Plätze mit ihrem Gelde kaufen, und die teuersten Zimmerfluchten standen ihnen in den besten Gasthäusern auf Wunsch anstandslos zur Verfügung.
In Indien jedoch, wie in allen englischen Besitzungen des Ostens, ist das anders. Überall macht die Unterkunft in den Gasthöfen Schwierigkeiten und muß sehr teuer bezahlt werden. Die besten Zimmer zu erhalten, ist ganz ausgeschlossen. Die Gäste englischer Abstammung wenden sich sowieso sofort an die Hotelleitung mit Beschwerden über die Anwesenheit eines „dreckigen Negers“ im Hause, drohen mit dem Boykott oder mit Veröffentlichung der Tatsache, die nur zu geeignet ist, die betreffenden Häuser bei den reisenden Engländern in schlechten Ruf zu bringen. Daß man jemals einen indischen Fürsten, sei er auch noch so reich, zu irgendwelchen Geselligkeiten der englischen Gesellschaft an den besuchten Plätzen einlüde, ist eine vollständige Unmöglichkeit.
Wenn dies seinen Grund auch zunächst in der allgemeinen Überheblichkeit und Unwissenheit des Europäers, und ganz besonders des Engländers, über die wirklichen Grundlagen der verschiedenen asiatischen Kulturen hat, deren, von der seinen so ganz[S. 44] verschiedenen, Aufbau und Entwicklung er verständnislos gegenübersteht, so spielen doch ebenfalls auch sehr praktische Fragen mit, diesen Standpunkt überall und weitestgehend durchzuführen. Im Verhältnis zwischen besonders Engländern und Asiaten — von afrikanischen Negern ganz zu schweigen — ist alles auf schärfste Betonung der Gegensätze zwischen Weißen und Farbigen angelegt. Nicht zum wenigsten dadurch, daß man immer und überall ohne jeden Unterschied der Bildung, der Stellung, der Würde, des Vermögens jeden Farbigen sich mit hochmütiger Geste vom Leibe hält und ihn vollständig von der Teilnahme am inner-gesellschaftlichen Leben ausschließt, hat man es erreicht, daß das ungeheuere Land Indien mit seinen weit über dreihundert Millionen Einwohnern sich einer Handvoll Engländern so viele Jahrzehnte hindurch willenlos gebeugt hat.
Dies hindert jedoch keinen der weißen Herren und Damen, ihrerseits die Gastfreundschaft eines reichen indischen Fürsten so viel wie nur immer möglich in Anspruch zu nehmen, seine Feste mitzufeiern, seine Pferde zu reiten, seine Jagden mit ihrer Gegenwart zu beehren, seine Geschenke anzunehmen, — und mögen über die Zustände an irgendeinem großen indischen Fürstenhofe noch so skandalöse Klatschereien im Umlauf sein, und Klatsch ist das Öl in den Rädern des anglo-indischen Gesellschaftslebens, — keiner der so hochmoralischen englischen Damen würde es einfallen, sich dadurch von einer Eintragung in das Besuchsbuch eines indischen Fürsten abhalten zu lassen.
Selbstverständlich waren diese Zusammenhänge auch Dschagatdschit Singh bekannt, und wie alle Inder, die in ihrer Eitelkeit äußerst empfindlich sind, fühlte er scharf und bitter das Zurücksetzende und Beleidigende dieser Behandlung. Daher auch seine Sehnsucht nach Europa und seine Vorliebe für den Westen, die sein erster Besuch nur um so fester gründen sollte.
Mit der Rani Kanari als zukünftige europäische Modedame zur Seite, drängte er darauf, die vizekönigliche Erlaubnis zu erhalten, die ihm 1893 auch zum ersten Male erteilt wurde. Sofort[S. 45] begannen die praktischen Vorbereitungen, die besonders hinsichtlich der nach Hindu-Begriffen unmöglichen Mitnahme der Rani Schwierigkeiten machten. Doch es wurde ein Ausweg gefunden. Die Rani reiste als Jüngling verkleidet, und wenn sie als solcher auch überall wegen ihrer Schönheit das größte Aufsehen erregte, so war dies doch immer noch nicht so schlimm, als sie in ihrer wirklichen Rolle als Rani des Maharadschas die Überfahrt von Indien nach Europa machen zu lassen[5].
Je näher Dschagatdschit Singh nun endlich dem Ziele seiner jahrelangen Sehnsucht, Paris, kam, desto höher stieg seine Erwartung. Er sollte auch nicht enttäuscht werden. Damals gehörten authentische indische Maharadschas noch zu den Seltenheiten, und man überhäufte ihn mit Einladungen.
Doch der Ehrgeiz des Fürsten stand nach anderem. Er wollte gleich dem späteren König Eduard VII. eine Rolle in der Welt, in der man sich nicht langweilt, spielen. Geld genug stand ihm zur Verfügung. Er war also im siebenten oder achten Himmel, als ihm eines Tages bei einem von ihm gegebenen Essen im Café de Paris durch irgendeinen der tönend betitelten französischen Rastas — sie stammen meistens aus der Walachei und ihre Titel bestenfalls vom Papste — die damals gefeiertste Schönheit der Pariser Lebewelt, Liane de Pougy, vorgestellt wurde. Sie war die geschiedene Frau eines französischen Marineoffiziers und lebte, dank der Freigebigkeit eines russischen Großfürsten, auf sehr großem Fuße, besaß einen selten schönen Juwelenschatz und war nicht zum wenigsten auch wegen ihrer prachtvollen Perlen berühmt.
Diese kleinen Nebendinge entgingen dem indischen Krösus, der sich stets mehr auf seine schönen Körpergaben als Adonis einzubilden liebte, als von seinen mehr praktischen Eigenschaften Gebrauch zu machen. Daher zweifelte er auch nicht daran, den russischen Großfürsten in den Gefühlen der schönen Frau ersetzen zu können und war begeistert, auf diese Weise Indien gegen[S. 46] Rußland in der glanzvollen Pariser Gesellschaft zum Siege zu verhelfen.
Liane de Pougy aber sah sich schon im Besitz eines neuen Prunkstückes für ihre Juwelensammlung und lud huldvollst den strahlenden Maharadscha zum Tee in ihre Wohnung in der Avenue du Bois de Boulogne. Um sich seiner Meinung nach würdig einzuführen, verlor Dschagatdschit Singh keine Zeit, sondern erstand promptest für zwölftausend Franken ein Armband bei seinem Hofjuwelier in der Rue de la Paix, der ihm sehr wahrscheinlich auch noch indische Preise machte, und sandte dieses Angebinde mit wohlgesetzten Worten der Schönen, die er Rußland zu entreißen gedachte.
Als er nun allein und ohne Adjutanten zu seinem Besuch in der Wohnung der gefeierten Liane eintraf und mit ihr am Teetisch saß, bemerkte er zu seinem Entsetzen, daß das ihn bedienende Mädchen mit spöttischem Lächeln ihm das ihrer Herrin gesandte Armband am eigenen Arm bei jeder Handreichung vor die Augen hielt.
Immerhin war er taktvoll genug, den ihm angetanen Affront ohne Erwähnung zu lassen, und auch Liane de Pougy, die ein Schmuckstück von märchenhaftem Wert aus der indischen Schatzkammer des Maharadscha erwartet hatte, ließ kein Wort über die Angelegenheit fallen. Anscheinend erschien ihr der indische Adonis zu sehr Othello, ein Gedanke, der allerdings Seiner Hoheit dem Maharadscha von Kapurthala niemals gekommen wäre.
Tief bedrückt von dem schmählichen Ausgang dieses ersten Abenteuers, das ich mir alle Mühe geben mußte, nicht ruchbar werden zu lassen, kam er zurück. Doch in seiner angeborenen Freundlichkeit lehnte er später nicht ab, der Hochzeit Liane de Pougys mit dem Zigeunerprinzen Ghika den Glanz seiner Anwesenheit zu leihen.
Die Rani Kanari vergnügte sich unterdessen auf ihre eigene Weise. Sie kostete alle Schnäpse und gab sich einem eingehenden Studium der verschiedenen Champagnermarken und Weinsorten[S. 47] hin. Dabei vernachlässigte sie aber ihre äußere Erscheinung nicht und erfüllte alle Wünsche des Maharadscha, indem sie in immer neuen und blendenden Toiletten die Rennplätze besuchte, wo sie mit mehr Glück als Verständnis wettete. Als man sie gar eines Tages in Auteuil für Cleo de Merode hielt und daraufhin ansprach, fühlte Dschagatdschit Singh sich für alle seine Mühe mit ihr reichlich belohnt. Was konnte ihm mehr schmeicheln, als daß seine Rani der damals auf dem Höhepunkt ihres Ruhmes als Weltdame stehenden Geliebten Leopolds, des Königs der Belgier, zum Verwechseln ähnlich sah?
Von Paris ging die Reise nach London, um der Königin von England Besuch zu machen, worauf die Weiterreise zur Weltausstellung in Chikago erfolgte. Dort machte der Maharadscha die Bekanntschaft der Familie Leiter, deren drei bildschöne Töchter ihn durch ihr ungezwungenes Benehmen auf das höchste begeisterten. Damals ahnte er noch nicht, wie teuer ihm die Bekanntschaft mit ihnen zu stehen kommen sollte, als die eine von ihnen Lord Curzon, den späteren Vizekönig von Indien, geheiratet hatte.
Der Aufenthalt in den Staaten dagegen gefiel ihm weniger. Man behandelte ihn mehr wie eine Kuriosität, ein sensationelles Ereignis, denn als tonangebenden Pariser Weltmann, und trug, trotz seiner Einladungen, die man sich gern gefallen ließ, die amerikanische Geringschätzung und Abneigung gegen jeden „Neger“ offen zur Schau. Enttäuscht fuhr er daher über England nach Indien zurück.
Das Diamant-Jubiläum der Königin Victoria sah uns wieder in Europa. Nach kurzem Aufenthalt in Paris rief die Pflicht. Wir mußten in das Hotel Cecil in London übersiedeln, und kurz darauf wurde der Maharadscha nach Windsor befohlen.
Die Königin Victoria zeigte in ihren letzten Lebensjahren gesteigertes Interesse für Indien und war soweit gegangen, selbst Hindostani zu lernen. Ihr Lehrer war ein Mohamedaner, Munschi Hafis, aus Agra, der am Hofe von St. James für[S. 48] einen gewissenlosen, geldgierigen, ränkevollen Emporkömmling galt. Daß ihm zur Ausübung solcher Eigenschaften genug Möglichkeiten zu Gebote standen, lag in dem Umstande, daß die Königin sich mehr und mehr mit eingeborenen indischen Dienern umgab und sich mit Vorliebe von ihnen im Park von Windsor spazieren fahren ließ. Bei diesen Gelegenheiten übte sie sich mit ihnen in Hindostani, wobei ihr nach indischer Art vornehmlich Klatschgeschichten vorgetragen wurden, deren Kenntnis sie dann wieder zu recht unangenehmen Maßnahmen für die Betreffenden veranlaßte. Da nach und nach die Königin niemals ohne indische Dienerschaft um sich zu haben war, konnte kein Weißer sie sprechen, ohne daß Munschi Hafis davon Kenntnis erhielt, denn die Inder verstanden alle genügend Englisch, um den geführten Gesprächen zu folgen.
Dabei waren diese Leute von einer unausstehlichen Hochmütigkeit und Überhebung, so daß das Leben des Hauspersonals der Königin während deren letzter Lebensjahre wenig friedlich verlief. König Eduard verlor keine Zeit, den intriganten Munschi Hafis an die Luft zu setzen.
In Windsor eingetroffen, wohin der Maharadscha zur Tafel befohlen war, machten wir einen Spaziergang im Schloßgarten. Dort traf der Maharadscha einige dieser Diener, die er in seiner freundlichen Art in ihrer Muttersprache anredete. Doch als auserwählte Lieblinge der weißen Königin behandelten sie ihn kaum als ihresgleichen, bis einige Goldstücke ihren Stolz schmelzen ließen und sie zu untertänigster Haltung veranlaßten.
Aus irgendeinem Grunde wurde von dem Haushofmeister der Königin übersehen, mir mitzuteilen, wo ich während meines Aufenthaltes im Schloß meine Mahlzeiten einnehmen sollte. Als daher der Maharadscha, dessen Zimmer an die meinigen stießen, von dem indischen Günstling der Königin, Munschi Hafis, der in indischer Tracht, mit Perlen und Edelsteinen geschmückt, erschien, zur Tafel abgeholt wurde und man unsere beiden Kammerdiener ebenfalls irgendwohin zum Essen führte, machte ich mich[S. 49] auf, um in dem dem Schloß gegenüberliegenden Gasthaus „Zum weißen Hirsch“ zu Abend zu essen.



Als ich abends zurückkam, fand ich den Maharadscha, von indischen Dienern umringt, im Salon unserer Wohnräume, freudestrahlend in die Betrachtung des Ordens versunken, den ihm die Königin eigenhändig überreicht hatte, wobei ich gesprächsweise erwähnte, wo ich meinerseits den Abend zugebracht hatte.
Im nächsten Jahre waren wir wiederum in England, und der Maharadscha wurde von neuem von der Königin eingeladen, nach Windsor zu kommen. Ich hatte noch nicht die Handschuhe abgestreift, als der oberste Hausverwalter, der „Chief Stewart“ der Königin, vor mir stand und mir die bittersten Vorwürfe machte. Zuerst verstand ich den Sinn der langen Rede durchaus nicht, bis mir klar wurde, daß meine vorjährige Bemerkung dem Maharadscha gegenüber hinsichtlich meines abendlichen Besuches des „Weißen Hirschen“ von den indischen Dienern gehört und der Königin überbracht worden war. Sie hatte dann den unglückseligen Vorstand der Hofverwaltung zur Rede gestellt, der selbstverständlich über den unerhörten Vorfall, daß Gäste ihrer britischen Majestät sich mühsam ihr Abendbrot in einem, sei es auch noch so nahen Gasthofe beschaffen mußten, entsetzt gewesen war, ganz abgesehen von dem Verweis, den er sich dank der indischen Zwischenträgerei zugezogen hatte.
Als ich ihm sagte, daß man doch nicht erwarten könne, ich werde, um meinen Hunger stillen zu können, in dem Riesenbau des Schlosses zu Windsor aufs Geratewohl umherirren, versprach er, mich dieses Mal selbst abzuholen, wodurch mir Gelegenheit geboten wurde, mit den hohen Dienern der hohen englischen Hofgesellschaft zu essen.
Nachdem ich dem Maharadscha sein Turban-Diadem und sein großes Perlenhalsband ausgehändigt hatte — die Verwahrung der Millionenwerte an Schmucksachen, die er mit sich führte, hatte ich übernommen, denn die Unerfahrenheit eines Inders wäre nur zu leicht von der Schlauheit irgendeines europäischen[S. 50] Liebhabers solcher Gegenstände ausgenutzt worden —, erschien dann auch der oberste aller oberen Diener der Königin, befrackt und besternt, und führte mich in das Speisezimmer der „unteren“ Hofgesellschaft. Dort fand ich die Stewarts und Kammerzofen der Elite der oberen englischen Zehntausend versammelt, alle in großer Toilette und von einer Haltung, die der der Herzöge, Lords und Barone an der „oberen“ Hoftafel nichts nachgab. Da war der Post- und Telegraphenverwalter, der Obergärtner, der Chef der Palastpolizei, die Vorsteherinnen der königlichen Wäschekammern, die der Kleiderschränke und was sonst noch Rang und Würde im königlichen Haushalt hatte. Ich selbst saß neben dem Großmogul dieser unmittelbaren Trabanten der Person ihrer großbritannischen Majestät, dem Chief-Stewart.
Auf der weißen Tafel lief ein zierliches Schienengleis ringsum, das in einem silbernen Behälter alle Sorten von Getränken enthielt, von denen ein jeder sich nach Belieben bedienen konnte. Jedoch dies Belieben unterlag einem leichten Zwange, indem nach jedem Gang — und ihre Zahl gab der der „oberen“ königlichen Tafel kaum nach — der Chief Stewart sich erhob und der Reihe nach das Wohl der Königin, das des Prinzen von Wales und absteigend der weiterfolgenden Mitglieder des königlichen Hauses ausbrachte, was jedesmal stehend unter Leerung der Gläser getrunken wurde. Diese „libationes ad majestatem“ brachten die Herrschaften sehr bald in eine etwas angeregte Stimmung. Als ich aber nach Aufhebung der Tafel und dem Abmarsch der Damen nach englischer Sitte in den anstoßenden Salons bat, mir ein Glas von dem berühmten alten Whisky des Schlosses zu geben, sah mich — fast hätte ich gesagt, Seine Hoheit — der Chief Stewart erstaunt an und erklärte mir, daß jeglicher Likör ebenso wie das Rauchen in den Schlössern ihrer Majestät verboten seien. Doch der Postverwalter erbarmte sich meiner und lud mich ein, das Ende des Abends bei ihm zu verbringen, wo, wohl wegen der Wahrung des Postgeheimnisses, die Überwachung der Befehle der Königin auf gewisse nur ihm bekannte Schwierigkeiten stieß.
[S. 51]
Der Maharadscha war von seiner Abendunterhaltung weniger befriedigt als ich. Er hatte auf die nächsthöhere Klasse des ihm im vergangenen Jahre verliehenen Sternes von Indien gehofft, aber nur ein, wenn auch annehmbares Abendessen erhalten.
Am nächsten Morgen saß ich vor acht Uhr, noch im Schlafanzuge, in dem Wohnraume unserer Zimmerflucht, als plötzlich ein Herr gemeldet wurde, Lord Strafford, der Oberhofmarschall der Königin, der dem meldenden Diener auf dem Fuße folgte. Mit liebenswürdiger Handbewegung schnitt er meine Entschuldigung über meinen unvollkommenen Anzug ab, und sagte, er müßte unbedingt und sofort den Maharadscha sehen, der, da er nie vor elf Uhr aufstand, natürlich noch zu Bett lag. Ich entschloß mich aber, den Fürsten zu wecken.
Vergeblich zerbrach sich der Maharadscha den Kopf, wo, wie und wann er wohl gegen die Hofetikette verstoßen haben könne und war entsetzt, als er hörte, daß ich mit dem Oberhofmarschall im Nachtanzug gesprochen habe. Zum Schluß sollte ich versuchen, festzustellen, was denn die Ursache dieses ungewöhnlichen und frühen Besuches sei, während er sich ankleidete.
Doch als ich hörte, daß es sich für den Maharadscha nur darum handele, sich in das Gästebuch einzutragen, war ich ganz damit einverstanden, daß dieser hochwichtige Akt sehr wohl von Dschagatdschit Singh im Bett vollzogen werden könne, und wir verfügten uns daher in das Schlafzimmer des Maharadscha, der immer noch darüber grübelte, welche Missetat er wohl begangen haben möge. Erleichtert atmete er auf, als der Oberhofmarschall ihm Buch und Feder reichte, um seinen Namen einzutragen, aber noch lange nachher war er tief entrüstet über die Unhöflichkeit, Gäste wegen einer solchen Kleinigkeit mitten in der Nacht im Schlafe zu stören. In Indien wäre man sicherlich mehr auf die Bequemlichkeit und das Wohl seiner Gäste bedacht, worin er unzweifelhaft recht hatte.
Überhaupt hatte der Aufenthalt im Schlosse zu Windsor wenig Angenehmes. Schon die Bedienung ließ zu wünschen übrig.[S. 52] An den altmodischen Schellen konnte man sich zum Glöckner ausbilden, ehe ein dienstbarer Geist sich zum Erscheinen bequemte; doch zum Empfang der Trinkgelder waren sie alle vollzählig und pünktlich zur Stelle.
Wir waren daher froh, wieder unsere Zimmer im Hotel Cecil in London beziehen zu können, wo der Aufenthalt zwar nicht so historisch-majestätisch, dafür aber mehr modern-menschlich war.
Immer auf der Jagd, seinen Ehrgeiz als Don Juan der großen Welt zu stillen und Indien auf seine Weise in Europa zur Geltung zu bringen, war es dem Maharadscha irgendwie gelungen, die berühmte Cavalieri kennenzulernen. Sie war als Blumenmädchen irgend jemandem aufgefallen, der sie für das Theater ausbilden ließ, wofür sie ihn mit einem Jungen beschenkte. Eine große, hoheitsvolle und doch anmutige Gestalt, war die berühmte Italienerin eine der ersten Schönheiten jener Jahre.
Aus irgendeinem Grunde suchte ich den Maharadscha an jenem Abend der Cavalieri in seinem Privatspeisezimmer nochmals auf und fand den Tisch für zwei Personen gedeckt. Da er die Rani Kanari auf das Land zu Bekannten gesandt hatte und er selbst meistenteils abends auswärts aß, fragte ich, wen er wohl erwarte. Freudestrahlend weihte er mich in das Geheimnis ein.
Er, der indische Maharadscha, sei von einer Dame auserwählt, die selbst von europäischen Fürsten umworben werde. Er war sichtlich ganz begeistert über seinen Erfolg, und ich war gespannt, ob sie, die Cavalieri, wohl überhaupt erscheinen werde. Und sie kam.
„Comment ça va, Maharadja!“ begrüßte sie ihn herablassend in ihrem italienischen Französisch.
Ich beglückwünschte ihn noch auf hindostanisch und warnte ihn vor unüberlegten Ausgaben, denn ich fürchtete neue Komplikationen.
Als ich gegen elf Uhr zurückkam, war der Wagen der Cavalieri verschwunden, und ich hörte, daß sie, ganz Liebenswürdigkeit und Anmut, kurz vorher das Hotel verlassen habe.
[S. 53]
Am nächsten Morgen suchte ich Dschagatdschit Singh auf und fand zu meinem Erstaunen im Wohnzimmer sein persönliches Scheckbuch offen auf dem Tisch liegen. Von bösen Ahnungen erfaßt, sah ich mir die letzte Seite an, wo ein Scheck über tausend Pfund an L. C. — L. Cavalieri — verzeichnet stand. Ich legte das Buch vorsichtshalber in eine Schublade und wartete ab, was ich wohl hören würde. Augenscheinlich war der Fürst nicht ganz so entzückt von seiner Eroberung wie am Abend vorher. Er teilte mir aber mit, ich möchte die Zimmerflucht neben der seinen bei der Hotelverwaltung für ihn belegen lassen, denn gegen vier Uhr würde die Cavalieri eintreffen, die ihre Wohnung im Savoy-Hotel aufgäbe, um ins Cecil überzusiedeln.
Obgleich die fraglichen Zimmer von einem deutschen Prinzen bestellt waren, gab die Hotelverwaltung doch dem Maharadscha den Vorzug. Dschagatdschit Singh beabsichtigte nach dem Tee mit der Cavalieri im Hyde-Park aller Welt seine Überlegenheit als Herzensbezwinger vor Augen zu führen. Im Hofe wartete sein offener Landauer mit den indischen Dienern. Der Teekessel summte. Die Brötchen lagen bereit. Doch keine Cavalieri kam. Mir ahnte Böses.
Endlich wurde ein Groom in das nahegelegene Savoyhotel gesandt, der mit der Nachricht zurückkam: Madame Cavalieri sei um elf Uhr früh mit dem Nordexpreß nach Petersburg abgereist!
Wie ich einige Tage darauf von dem mir gut bekannten Leiter des Savoy-Hotels, dem berühmten Hotelier Ritz, erfuhr, hatte sie ihre langausstehende Rechnung mit einem Scheck des Maharadscha von Kapurthala über tausend Pfund beglichen und sich den überschießenden Betrag auszahlen lassen.
Dschagatdschit Singh war tief unglücklich. Nur die Rani Kanari, die selbstverständlich davon erfuhr, freute sich.
Möglicherweise trug diese Enttäuschung zu einem der für Dschagatdschit Singh sicherlich schwierigsten Entschlüsse bei, den er je durchgeführt hat: sich die Haare schneiden zu lassen. Es geschah[S. 54] dies in Ostende, und auf die Nachricht, daß Felix Faure eine offizielle Reise an den Hof von St. Petersburg machen würde, beschloß der Maharadscha, ebenfalls dorthin aufzubrechen. Vor dem Antritt dieser Reise vollzog sich nun dieses unerhörte Ereignis des Haareschneidens.
Dschagatdschit Singh gehörte der Kaste der Sikh an, deren Kastenabzeichen gerade das ungeschnittene Haar ist. Sie tragen es zu einem Knäuel geschlungen unter dem Turban, und es ist Todsünde, es mit der Schere zu berühren. Jedoch die langen Haare sind äußerst lästig, denn sie müssen oft gewaschen werden, und das Trocknen nimmt viel Zeit in Anspruch. Dazu bedingen sie das ständige Tragen eines Turban, und den Turban wieder muß ein Jeder kunstgerecht sich selbst binden, da es eine außerordentliche Kunstfertigkeit und Übung erfordert. Nur der Träger kann ihn so um den Kopf legen, daß er gut Halt hat und kleidsam wirkt. Jedoch mit dem Turban angetan war der Maharadscha auf einen Kilometer als Inder kenntlich. Den Turban aber ablegen und die Haare behalten war ebenfalls unmöglich, also ließ er sich, ohne jemandem ein Wort davon zu sagen, die verräterischen und lästigen Haare abschneiden. Und erschien im Hut!
Sein indisches Gefolge war entsetzt, bestürzt, ganz verstört, fürchteten sie doch alle von dem Sikh Guru, dem Priester, zu schwerer Rechenschaft gezogen zu werden. Doch der Maharadscha blieb gleichmütig; wie man die Sache in der Heimat vertuschen werde, würde sich schon finden.
Zunächst ging es nach St. Petersburg. Die erste Person, die er dort im Hotel Europa trifft, ist die Cavalieri. Sie stand unter dem Schutze des Prinzen Baratinski, der als vorzüglicher Pistolenschütze bekannt war und sehr eifersüchtig sein sollte.
Ein Duell zwischen ihm und dem Maharadscha um einer treulosen Neapolitanerin willen war keine Aussicht, die mich mit irgendwelcher Freude erfüllen konnte. Ich gab mir also redlich Mühe, den Maharadscha zu beruhigen, und es gelang mir auch,[S. 55] daß er seine Begegnungen mit der Dame in den Grenzen strikter Höflichkeit hielt.
Petersburg jedoch vermochte Dschagatdschit Singh nicht lange zu fesseln. Wohl wurde er zu einem Empfang im Winterpalast und zu einer Truppenschau in Krasnoje Selo geladen, im übrigen aber ziemlich gleichgültig behandelt. Auch erregte seine große Gestalt, trotz aller Orden und Edelsteine, unter den reichen Uniformen und den nicht minder kräftig gebauten russischen Offizieren kein besonderes Aufsehen. Dann war er als englandfreundlicher Fürst bekannt, und die Völker des nahen Ostens waren England wegen seiner Politik an den Grenzen Indien-Afghanistans nicht zugetan. Dazu noch die peinliche Nähe der Cavalieri!
Kurz, der Maharadscha schüttelte bald den Staub der russischen Residenz und Hauptstadt von seinen Füßen und begab sich über Kiew — wo zu seiner Ehre Galavorstellungen im Theater, Bälle und Festessen gegeben wurden, und wo die polnischen Damen seiner Adoniseinbildung in jeder Weise und mit Hingabe entgegenkamen — zunächst nach Odessa und von dort nach Konstantinopel.
Obgleich der Sultan ihn durch einen seiner Adjutanten, den Generalleutnant Ali Khan, im Hotel begrüßen ließ, der sich ihm während seines Aufenthaltes in der osmanischen Hauptstadt zur Verfügung stellte, war dennoch die Abneigung zu spüren, welche die Türken gegen alle empfanden, die einen nicht-mohamedanischen Turban tragen. Auch war es bekannt, daß gerade Kapurthala-Truppenkontingente gegen die mohamedanischen Afridis gekämpft und dabei schwere Verluste erlitten hatten.
Daher war es auch nicht verwunderlich, daß man dem Wunsch des Maharadscha, vier prachtvolle Araberpferde zu erwerben, die ihm bei einem Besuche des kaiserlichen Marstalles in Konstantinopel aufgefallen waren, nicht stattgab. Mich betrübte dies sehr, doch man gab uns unzweideutig zu verstehen, daß man nicht die Absicht habe, so wertvolles Material Ungläubigen zu überlassen.
[S. 56]
All dieses, sowie die ganze Atmosphäre von Mißgunst und Mißtrauen, die uns hier umgab, bewogen den Maharadscha, Konstantinopel bald zu verlassen. Über Wien und München, von wo aus wir noch die den Maharadscha höchlichst interessierenden Schlösser König Ludwigs II. von Bayern besuchten, kehrten wir nach Paris zurück, um im Grand-Hotel wiederum Wand an Wand mit der anscheinend unvermeidbaren Cavalieri zu wohnen. Schon wollte der Maharadscha das Hotel wechseln, als eines Tages die schöne Neapolitanerin verschwunden war; sie war nach Amerika abgereist.
Bald darauf traf auch die Rani Kanari in Paris ein, und die Familie des Maharadscha kehrte für die kalte Jahreszeit nach Indien zurück. Diesmal für lange!
Denn als Dschagatdschit Singh im folgenden Jahre um die Erlaubnis, nach Europa reisen zu dürfen, einkam, wurde sie ihm verweigert.
Die anglo-indische Regierung wußte sehr wohl, daß der Maharadscha von Kapurthala seine Zeit in den Ländern des Westens nicht mit Studien verbrachte, durch die er irgendwelche Verhältnisse in seinem Staate oder auf seinen Besitzungen in Oudh verbessern könne. Gewiß, man erkannte gern an, daß er sich stets englandfreundlich bewies und sich seine Ideale aus Europa holte. Doch diese Ideale waren der Regierung zu persönlicher Art, und man wußte nur zu genau, daß jeder Inder, der europäische Sitten und Gebräuche annimmt — wobei zu beachten ist: ohne daß er sich zum Christentum bekehrt —, sogleich und vor allen Dingen die Laster der Weißen sich angewöhnt, ohne auf die ihm angeborenen indischen zu verzichten. Daher ist die Regierung den loyalen einheimischen Fürsten, die fest an den Überlieferungen und Gesetzen ihrer Vorfahren und ihres Landes halten, viel mehr gewogen. Denn dies Verhalten übt auch seinen Einfluß auf die Bevölkerung aus, und ein indischer Inder ist leichter zu beherrschen, als einer, der durch europäische Erfahrungen zu Vergleichen, zu Wünschen und Bestrebungen angeregt wird, welche[S. 57] die ungestörte englische Herrschaft über Indien nicht zu festigen geeignet sind.
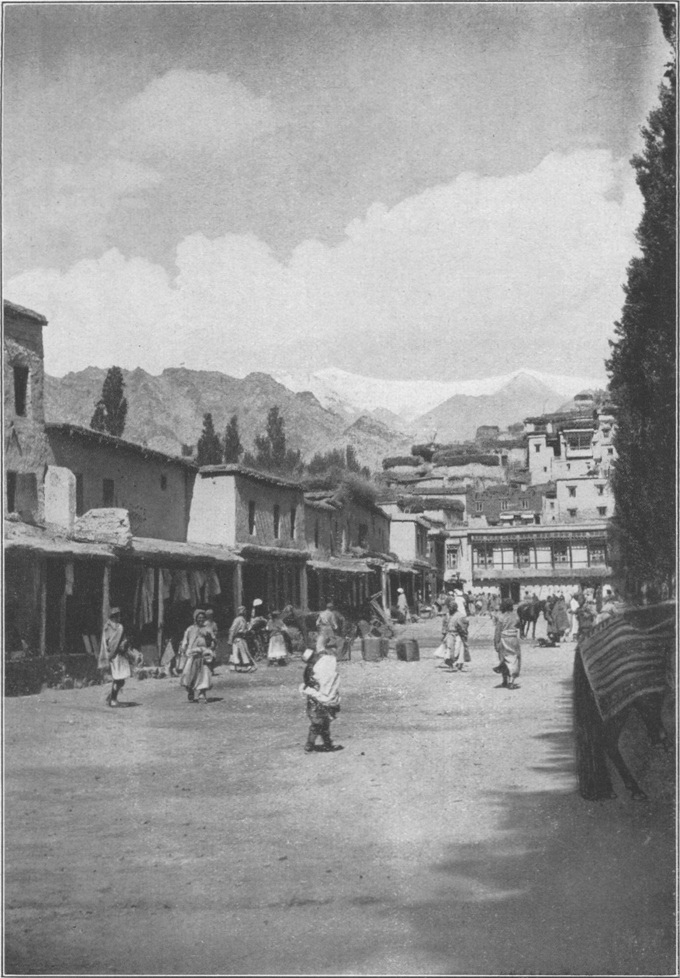

Die außerordentliche Ungerechtigkeit dieser Behandlung liegt aber vor allem darin, daß die jungen indischen Fürsten, die unter die direkte Obhut Englands fallen, wie dies bei Siyadschi Rao und ebenso bei Dschagatdschit Singh der Fall war, zunächst vollständig auf englischer Grundlage erzogen und ihnen ausschließlich europäische Wissens- und Bildungsgrundlagen beigebracht werden, und daß so die englischen Lehrer den jungen, stets sehr geweckten und aufnahmefähigen Geist des Inders mit rein europäischen Anschauungen füllen. Bei erlangter Volljährigkeit wird er seiner indischen, in indischen Begriffen erzogenen und aufgewachsenen Umgebung vorbehaltlos zurückgegeben. Man zieht sich ganz von ihm zurück und behandelt ihn gesellschaftlich als „damned nigger“, als „dreckigen Neger“.
Welche politischen und Opportunitätsgründe man auch hierfür ins Treffen führen mag, der ganze Charakter eines so unglücklich gestellten Menschen muß notwendig darunter leiden. Die ganze Behandlung ist, individuell gesehen, ein grobes Verbrechen an vollständig wehrlosen Kindern ad majorem, wenn auch nicht gloriam, so doch utilitatem Britanniae.
Nur ein im Innersten so gutmütiger und freundlicher Mensch wie Dschagatdschit Singh konnte, ohne bis ins Tiefste verbittert zu werden, diese ihm aufgezwungene innere Zwiespältigkeit ertragen. Bei anderen, wie dem Maharadscha Siyadschi Rao, führte sie bis zu den äußersten Grenzen der Auflehnung, bis zu denen die Herrscher überhaupt wagen dürfen zu gehen.
Doch die Weigerung des Vizekönigs, Dschagatdschit Singh die Reise nach Europa zu erlauben, hatte einen tieferen, weniger abstrakten oder politischen Grund. Lord Curzon, der damalige Vertreter des englischen Königs in Indien, stand vor seiner Abberufung. Er brauchte daher nicht mehr allzusehr auf persönliche Feindschaften, die er sich zuziehen mochte, Rücksicht zunehmen. Der Grund, der ihm den Maharadscha von Kapurthala besonders[S. 58] verhaßt machte, lag in etwas, an dem der indische Fürst selbst vollständig unschuldig war.
Wie schon erwähnt, hatte Dschagatdschit Singh auf seiner ersten Reise die Bekanntschaft der Familie Leiter in Chikago gemacht, deren Töchter durch ihre Ungebundenheit Gegenstand seiner besonderen Bewunderung geworden waren. Nun hatte Lord Curzon die älteste dieser Leiter-Töchter geheiratet, und als die Krönungsfeierlichkeiten des Königs Eduard zum Kaisar-i-Hind durch den damaligen Vizekönig, eben diesen Lord Curzon, in Delhi abgehalten werden sollten, eilte Frau Leiter mit ihren beiden jüngeren Töchtern herbei, um die älteste und den hohen Schwiegersohn im Glanze des Kaiserthrones in der Hauptstadt Indiens zu bewundern. Alle indischen Fürsten, außer dem Gaekwar von Baroda, waren erschienen, und unter den fast fünfhundert Maharadschas, Nisams, Radschas, Maharanis, Begums, Nawabs und sonstigen Großen verschwand der Maharadscha von Kapurthala.
Wenn er nun auch nicht wagen konnte, der Gemahlin des „Bara-Lord-Sahib“, des Vizekönigs, sich zu nahen, so kam ihm doch der Gedanke, daß deren Mutter und Schwestern im Grunde Privatpersonen seien, gegenüber denen es wohl möglich wäre, die ihm früher in Amerika erwiesene Gastfreundschaft durch eine Einladung zu erwidern.
Er sandte also einen seiner höchstgestellten Beamten mit einer ebenso würdevollen wie freundlich gehaltenen Einladung an die jungen Damen Leiter — die Mutter war in Kalkutta zurückgeblieben —, als sie unter der Obhut des Generals Sir Bindon Blood und seiner Gattin zufällig in der Nähe von Kapurthala auf der Jagd waren. Die Einladung wurde in liebenswürdiger Form angenommen und eine baldige Ankunft in Aussicht gestellt.
Sofort gab der Maharadscha die nötigen Befehle, seine Gäste auf das beste zu empfangen, und überzeugte sich persönlich, daß in den Bungalows, die der Gesellschaft der Damen Leiter zur Verfügung gestellt werden sollten, auch nicht das Geringste für ihre Bequemlichkeit vergessen sei.
[S. 59]
Zur Feier des Ereignisses ergingen unzählige Einladungen nach allen Ecken und Enden Indiens, um möglichst viele Bekannte und Freunde von der vollendeten Lebensart und dem europäischen Takte Dschagatdschit Singhs zu überzeugen. Spiele, Jagden, Bälle wurden in Szene gesetzt, und die ganze Bevölkerung Kapurthalas war glücklich über die glanzvolle Prachtentfaltung, mit der ihr Maharadscha den fremden Gästen, den Schwestern der Gemahlin des Vizekönigs, die hohe Bedeutung und die Zivilisation ihres Staates vor Augen führte.
Kaum aber hörte der Vizekönig von dem Besuche seiner Schwägerinnen bei dem in den geheimen Konduitenlisten der Regierung als schwersten Schwerenöter geführten Maharadscha von Kapurthala, als er umgehendst eine höchsteigene Staatsdepesche sandte, in der er den sofortigen Abbruch des Besuches anbefahl.
Jedoch die jungen Damen waren ja nicht mit Lord Curzon, dem Vizekönig seiner britischen Majestät, verheiratet und lachten über die ängstliche Besorgtheit ihres lieben Schwagers Georg. Sie dachten gar nicht daran, sich all die Vergnügungen entgehen zu lassen, die sie in Kapurthala so verschwenderisch vor sich ausgebreitet liegen sahen, und blieben.
Darauf erschien in fliegender Hast ein vizeköniglicher Adjutant, um sie zu bewegen, sofort den unziemlichen Ort zu verlassen. Doch auch jetzt ließen sie sich nicht beeinflussen, sondern nahmen von dem freundlichen und behaglichen Kapurthala trotzig erst dann Abschied, als ihre Reisepläne sie nach anderen Orten führten.
Diese Angelegenheit, in der der Maharadscha, sicherlich nicht unbeeinflußt von seiner Eitelkeit, mit großer Freundlichkeit und in aller Unschuld durchaus korrekt gehandelt hatte, als er sich bemühte, Gastfreundschaft mit Gastfreundschaft zu vergelten, erregte den heftigsten Zorn des Vizekönigs, der dadurch noch gesteigert wurde, daß seine Schwägerinnen seinen hochmögenden Anordnungen nicht sofort Folge geleistet hatten. Dschagatdschit Singh mußte nun unter diesem Unwillen leiden. Lord Curzon sperrte ihm die Ausreiseerlaubnis, so daß für den indischen Fürsten[S. 60] keine Möglichkeit bestand, sein geliebtes Europa in den nächsten Jahren wiederzusehen.
In der Zwischenzeit wurden die verschiedenen Bergfrischen im Himalaja aufgesucht, sowie eine Reise nach China und Japan unternommen. Auch der Bau eines Palastes in Mussoorie im Stile Ludwigs XIV. brachte Abwechslung, bis endlich Lord Minto, der bis dahin die britische Majestät in Kanada vertreten hatte, Lord Curzon in Indien ablöste. Bald darauf traf auch die langersehnte Erlaubnis, nach Europa reisen zu dürfen, ganz unerwartet nach fünfjähriger Unterbrechung ein.
Sofort wurden die nötigen Anweisungen gegeben. Seine vier Söhne, die ihm drei verschiedene Mütter geboren hatten, sollten vorausreisen, denn ihr Gezank und Gezeter untereinander hatte nichts besonders Beruhigendes an sich, obgleich Dschagatdschit Singh sie sehr liebte und sie sehr gleichmäßig und ohne Begünstigung behandelte.
Seine Begleiterin sollte die Rani Kanari sein, in die der Maharadscha damals viel Vertrauen setzte. Übrigens zog er es vor, allen häuslichen Unannehmlichkeiten weit aus dem Wege zu gehen, indem er einfach beide Augen zumachte. „Life is short and one is dead a very long time“ — kurz ist das Leben, und man liegt recht lange im Grabe —, pflegte er zu sagen, wenn er sich mit unangenehmen Dingen beschäftigen sollte.
Zudem hatte die Rani Kanari bei einer von ihr unternommenen Wallfahrt nach Hartwar zum Baden im heiligen Fluß, im Ganges, geschworen, kein berauschendes Getränk mehr über die Lippen zu bringen. Wenn der Maharadscha selbst auch der heiligen Handlung keine Bedeutung beimaß, so war er doch überzeugt, daß sie für die Rani volle Gültigkeit habe und daß sie den ihren Göttern geleisteten Schwur auch halten werde. Seine durch ihre Unmäßigkeit erschütterte Zuneigung zu ihr erwachte zu neuem Leben und damit sein Vertrauen in sie.
Doch die schöne Rani Kanari war rettungslos dem Trunkteufel verfallen. Unwohlsein vorschützend, zog sie sich in ihre Gemächer[S. 61] zurück und verbot jedermann, auch dem Maharadscha, ihre Türe, was nach Hindusitte nichts Ungewöhnliches hat. Doch sie benutzte diesen Vorwand nur, um sich halbe Wochen lang dem stillen Trunke hinzugeben. Als nun eine solche Periode sich länger als gewöhnlich hinzog, wurde der Maharadscha besorgt und befahl, nach dem Arzte zu senden, da er irgendeine Gefahr befürchtete, die seiner Rani drohen konnte. Er besprach die Sache mit mir und bat mich, das Erforderliche zu veranlassen, als sich sein anwesender Leibdiener einmischte und Zweifel an der Krankheit äußerte. Er wisse, die Rani könne noch immer flaschenweise Kognak trinken. Ein anderer Diener, der mit der Aya, der Kammerzofe der Rani Kanari, unter einer Decke stecke, habe ihr noch am Morgen vier Flaschen Hennessy gebracht, von denen zwei schon leer seien. Die beiden anderen stünden noch unberührt im Wandschrank.
Der Maharadscha war so entsetzt, daß er die Sprache verlor. Die Beschuldigung des Dieners gegen seine Lieblingsfrau traf ihn, nach allem, was sie versprochen hatte, wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Endlich sprang er auf, um, allen Sitten und Gebräuchen zum Trotz, sich Zutritt zu den Gemächern der Rani zu erzwingen. Mir winkte er zu folgen. Mit wenig angenehmen Gefühlen kam ich seinem Wunsche nach und hoffte nur, daß es mir gelingen möge, allzuweit gehende Maßregeln zu verhüten.
Entsetzt fuhr die Rani Kanari von ihrem Bett in dem halbdunklen, kühlen Gemach, das sie als Schlafzimmer benutzte, in die Höhe, als der Maharadscha unangemeldet eintrat. Der Fluß der Räubergeschichten, welche die am Fußende des Bettes hockende Aya eintönig erzählte, brach jäh ab. Mit dem Aufgebot aller Willenskraft sammelte die arme Frau ihre halbbetäubten Geisteskräfte, und es gelang ihr auch, mit überzeugender Treue die Schwerkranke zu spielen. Flasche und Glas, die sie soeben noch benutzt hatte, waren unter der Bettdecke verschwunden.
Doch der Duft des Kognaks, der das Zimmer erfüllte, ließ sich durch keine Schauspielerkünste aus der Welt schaffen. Ohne[S. 62] ein Wort zu sagen, geht der Maharadscha zu dem Wandschrank, öffnet ihn und findet dort allerdings nur noch eine Flasche des scharfen Getränkes. Das war zu viel. Unter heftigen Vorwürfen über ihren Treubruch und über ihren Meineid vor den Göttern gießt er ihr den Inhalt der Flasche über den Kopf.
Weinend und mit den echtesten Zeichen tiefster Reue stürzt die Rani ihm zu Füßen und bittet um Verzeihung. Doch er bleibt unerbittlich. Anstatt mit ihm nach Europa zu reisen, soll sie den Sommer in ihrem gottverlassenen kleinen Heimatsort Dschubul im Gebirge in Verbannung verbringen.
Ohne sich umzusehen, geht er aufgeregt in sein Arbeitszimmer zurück, wo er mir ein Telegramm diktiert, in dem er die schon für die Rani bestellten Dampferplätze wieder frei gibt. Doch wie sollte der Maharadscha ohne seine ihm doch unentbehrliche Rani Kanari reisen? Alle Fehler, die sie zweifellos hatte, waren zum Schluß doch nur die Fehler oder wenigstens die Folgen ihrer Tugenden. Ich mußte suchen, die Verbannung nach Dschubul rückgängig zu machen. Die Rani mußte an der Europareise teilnehmen. Mein Plan war schnell gemacht. In aller Eile sandte ich das Telegramm wegen der Abbestellung der Dampferplätze ab.
In all den Jahren, die ich im Dienste des Maharadscha zugebracht hatte, war es zur Gewohnheit geworden, daß ich mich morgens beim Frühstück als erster zu seiner Begrüßung einstellte. Er hatte es gern, mich zu sehen. Die Frische meiner Gesichtsfarbe und meines Auftretens bringe ihm Glück den ganzen Tag über, meinte er oft.
Diese Gelegenheit benutzte ich, mich in seinem eigenen Interesse für die Rani Kanari zu verwenden. Wohl wies er mich zunächst ab, aber als ich immer und immer wieder darauf zurückkam und ihm auseinandersetzte, wie zum Schluß er selbst doch den Keim zu der unglückseligen Neigung in die Rani gelegt habe, siegte seine angeborene Gutmütigkeit. Ihm zuliebe habe sie sich an die ihr fremden Spirituosen gewöhnt, und es sei doch nicht ihre Schuld, daß ihr um so viel schwächerer Körper, als der[S. 63] seine, den Folgen des Trinkens nicht widerstehen könne; auch habe sie, um ihm zu gefallen, alle Vorschriften ihrer Kaste als Radschputin verletzt. Endlich willigte er ein, daß auf der „Arabia“, die vierzehn Tage nach seiner, des Maharadscha, festgesetzten Abreise Bombay verließ, Kabinen für die Rani Kanari bestellt würden. Ich aber sollte sie begleiten und dafür sorgen, daß sie an Bord nicht wieder in ihre alte Schwäche zurückfalle.
Mit zwei indischen Kammerzofen und einer englischen Beamtenwitwe als Gesellschafterin schifften wir uns zwei Wochen nach dem Maharadscha auf der „Arabia“ ein. Kurz vor seiner Abreise hatte er ihr noch persönlich seine Verzeihung ausgesprochen. Er glaubte sie jetzt gründlich und für immer von ihrem Leiden geheilt. Die Rani selbst war aber nicht sonderlich erfreut. Sie liebte Europa nicht, und es war ein Irrtum des Maharadscha, anzunehmen, daß jeder mit denselben Glücksgefühlen in den schönen Städten des Westens spazieren ginge, wie er selbst.
In Port Said kam zufällig die Ex-Kaiserin Eugenie an Bord, welche die „Arabia“ zur Rückfahrt nach Marseille benutzte. Ihre Kabinen waren denen der Rani benachbart. Wenn es der Rani Kanari gelang, in Berührung mit der Kaiserin zu kommen, so konnte sie sicher sein, daß der Maharadscha sie mit offenen Armen empfangen würde. Ich sprach daher mit ihr und empfahl ihr, das größte Entgegenkommen zu zeigen.
Wie vorauszusehen, kam auch noch am Tage der Abfahrt von Port Said der Adjutant der Kaiserin und bat mich, ihn der Rani vorzustellen, um sie bei der Ex-Kaiserin einführen zu können. Nach Port Said trafen sich die beiden Damen des öfteren im Salon der Kaiserin, die sehr anziehend war. Schon damals ging sie am Stock. Die Rani zeigte sich so gewinnend, daß sie noch vor Ankunft des Dampfers in Marseille von der Ex-Kaiserin zum Besuch auf ihre Villa in Cap Martin, in der Nähe von Monte Carlo, eingeladen wurde. Von Marseille drahtete ich erfreut an den Maharadscha und erbat seine Einwilligung, die umgehend eintraf. Freudestrahlend eilte er sogar seiner Rani entgegen und[S. 64] begrüßte sie aufs herzlichste bei der Durchfahrt auf dem Bahnhofe in Monte Carlo.
Nach zweitägigem Aufenthalt nahmen wir Abschied von der Ex-Kaiserin. Die Gesellschaft einer älteren Dame war nicht nach dem Geschmack der Rani, und für die Eitelkeit des Maharadscha hatte sie ihrer Meinung nach genug getan. Auch fehlten ihr die Kenntnisse, eine Unterhaltung zu führen in der in Cap Martin üblichen Art.
In Paris trafen wir dann mit dem Maharadscha zusammen, der glücklich war, seine Rani wiederzusehen. Doch dies Glück sollte sich bald verflüchtigen.
Trotz aller Beteuerungen und Versprechungen konnte die Rani Kanari ihrer traurigen Neigung nicht widerstehen. Und soviel Mühe ich mir auch gab, die Anfälle zu vertuschen und sie nicht zur Kenntnis des Maharadscha gelangen zu lassen, immer ließ es sich nicht vermeiden. Damit verlor er immer mehr auch den letzten Halt, der ihn mit seiner indischen Familie verband, und er wandte sich mit unzerstörbarem Eigensinn von neuem seinen westlichen Idealen nur umso stärker zu.



[S. 65]

Da der Grundzug der Regierung des neuen Vizekönigs von Indien, Lord Minto, Liberalität und Entgegenkommen, besonders den einheimischen Fürsten gegenüber, war, so machte es 1906 keine Schwierigkeiten, die notwendige Reiseerlaubnis zu erhalten, um zum fünften Male Europa aufzusuchen.
Doch die Ausgaben für die Palastbauten in Mussoorie und in Kapurthala, sowie die Kosten der Erziehung seiner Söhne erforderten große Summen. Daher sollte diesmal das Gefolge auf das Notwendigste beschränkt werden. Die sich ständig wiederholenden „Anfälle“ der Rani Kanari bestimmten ihn, von ihrer Begleitung abzusehen und dafür zwei andere seiner Zenanafrauen, die Maharani — die erste der Zenanafrauen — und die Rani Barbotti, deren Söhne sich in einer Schule bei Paris befanden, mitzunehmen.
[S. 66]
Mit den Jahren und wohl auch infolge des Beispieles der Rani Kanari hatten sich ihre starren Kastenvorurteile etwas gemildert, und sie waren bereit, auf den Wunsch des Maharadscha, ihn zu begleiten, einzugehen. Dschagatdschit Singh hoffte, daß sie, fern der Heimat und der ständigen Überwachung ihrer indischen Umgebung entrückt, auch von ihren Skrupeln etwas aufgeben würden. Doch das Gegenteil trat ein. Sie legten es scheinbar darauf an, die Vorschriften ihrer Religion noch strenger als gewöhnlich zu beachten, schon weil sie durch ihre Reise über das „Kali Pani“, das Schwarze Meer, sich verunreinigt glaubten. Unermüdlich bestürmten sie den Maharadscha mit ihren Klagen über verletzte Kastengesetze, so daß er sich zum Schluß nicht anders zu helfen wußte, als sie möglichst weit von seinem eigenen Hotel unterzubringen.
Sicherlich kennt man in Indien weder Eifersucht noch wahre Liebe, und die Seele ist für den Inder nur eine Erfindung Europas. Der Maharadscha versorgte seine Frauen mit allen Bequemlichkeiten, erfüllte ihre tausend kindlichen Wünsche und ließ es ihnen an nichts fehlen. Wohl erhoben sie manchmal ein großes Jammern über seine Seitensprünge, doch zum Schlusse jammerten sie in der gleichen Weise über alles Mögliche, was sie zufälligerweise und vorübergehend unangenehm berührte. Die Untreue des Maharadscha entsprang vor allem seiner Erziehung, seiner Sehnsucht nach dem — doch immer unerreichbaren — Ideal einer europäischen Lebensführung, dem Suchen nach einer europäisch verstehenden Gefährtin, dem die unglückliche Rani Kanari immer noch am nächsten gekommen war, bis er sich auch von ihr enttäuscht sah.
Um soviel wie möglich den ständigen Szenen, die ihm von seinen Zenanafrauen aus allen möglichen und unmöglichen Gründen gemacht wurden, zu entgehen, und um seiner Eitelkeit einen neuen Rahmen zu geben, benutzte er die Hochzeitsfeierlichkeiten des Königs Alfons XIII. von Spanien und begab sich nach Madrid. Er war zwar nicht eingeladen, hoffte aber, es eher zu werden,[S. 67] wenn er am Platze sei. Doch bei dem unvermeidlichen Ordensregen, der aus dem spanischen Hochzeitshimmel auf die teilnehmenden Gäste herabregnen würde, mußte auch der Maharadscha als Hochzeitsgast mit einem der stolzen spanischen Ehrenzeichen bedacht werden. Nun aber sieht es die indische Regierung nicht gern, wenn der Glanz ihrer eigenen Auszeichnungen auf der Brust der Träger durch die Pracht fremder Sterne und Kreuze überstrahlt wird. Daher unternahm die englische Botschaft in Madrid die notwendigen Schritte, um die Einladung zu hintertreiben.
Dafür wurde Madrid selbst um so gründlicher in Augenschein genommen. Kein Theater, kein Kasino, keine Stierkampf-Arena wurde ausgelassen. Im Verfolge dieser anstrengenden Beschäftigung landeten wir so eines Abends in dem „Kursaal-Varieté“, einer Bühne recht sehr zweiten Ranges. Die Darbietungen waren so mittelmäßig, daß wir schon im Begriff standen, wieder aufzubrechen, als zwei spanische Tänzerinnen, zwei Gitanas, erschienen, die etwa 16 und 17 Jahre alt sein mochten. Sie hatten kaum einige Schritte getanzt, als der Maharadscha mit allen Zeichen der höchsten Spannung die Bühne ins Auge faßte. Und in der Tat, die beiden Mädchen waren von ganz auffallender Schönheit. Kaum daß der Tanz beendet war, als Dschagatdschit Singh sich mit dem ganzen Selbstbewußtsein eines indischen Herrschers mir zuwendete und sagte:
„Dies ist die Erfüllung des Wunsches meiner Träume! Sie ist für mich geschaffen!“
Welche der beiden tanzenden Gitanas für ihn geschaffen sein sollte, war mir nicht klar. Und noch weniger konnte ich damals ahnen, daß nicht nur das Leben des Maharadscha, sondern auch mein eigenes, ja das aller Bewohner des ganzen Palastes im fernen Kapurthala Indiens von diesem Augenblick an den seltsamsten Veränderungen entgegengehen sollte.
Auf Wunsch des Maharadscha wurden die beiden Tänzerinnen zum Souper eingeladen, wobei die Mädchen in Begleitung ihrer[S. 68] Eltern, eines Servierkellners des Theaters als Vater und einer Logenschließerin als Mutter, erschienen. Da niemand von der Familie etwas anderes als Spanisch sprach, was weder der Maharadscha noch ich beherrschten, mußte unser Fremdenführer, ein Schweizer, dolmetschen.
Und die Schönheit der Mädchen verlor auch bei näherer Bekanntschaft nichts von ihrer Wirkung. Die für den Maharadscha „Geschaffene“ war die ältere und hieß Anita; der Name der jüngeren war Vittoria, und die Familie nannte sich Delgado.
So europäisch Dschagatdschit Singh sich auch in seinem Auftreten und in seinen Idealen zu geben bemühte, im Innern waren ihm europäische Anschauungen doch vollständig fremd. Als er mir daher mitteilte, daß er, genau wie er die Rani Kanari auf dem Sibi-Markte bei Simla gekauft habe, nun auch Anita kaufen wolle, und daß ich diesen Handel sofort in die Wege leiten und durchführen sollte, war ich weniger erstaunt als entsetzt.
Ich hatte noch vor der Abreise besondere Andeutungen seitens der anglo-indischen Regierung erhalten, nach jeder Richtung hin über das Verhalten des Maharadscha zu wachen, insoweit es seine Stellung und sein Ansehen in seinem Staate berührte. Was aber konnte in dieser Richtung gefährlicher wirken als eine weiße Rani, die nicht nur von der Meinung seiner Untertanen verworfen würde, sondern die auch in jeder Weise alle Anschauungen der Regierung selbst gegen sich haben mußte?
Doch trotz langer Auseinandersetzungen blieb der Maharadscha auf seinem mehr Befehl als Wunsch bestehen: Anita Delgado sollte gekauft werden! Umsonst wies ich ihn darauf hin, daß in Europa der Frauenkauf nicht möglich sei. Mit einer Handbewegung, wie sie der Sohn Massinissas, Jugurtha, der Numidier, gehabt haben mag, als er Rom mit dem Ausrufe verließ: „O Roma venerabilis, si emptorem invenerit!“, wiederholte er dem Sinne nach dieselben Worte: „Hier ist alles käuflich!“
Wie sollte ich ihm das, europäischem Denken so stark Zuwiderlaufende seiner Absicht klarmachen? Er verstand mich nicht,[S. 69] konnte mich aus seinen Anschauungen heraus auch nicht verstehen, — und wie die Entwicklung später zeigte, hatte er recht, nicht ich. Sowohl die Eltern Delgado, wie auch die Töchter waren ohne weiteres bereit, auf den Handel einzugehen.
Schweren Herzens entschloß ich mich zum Schluß, die Aufgabe in die Hand zu nehmen, denn ich wußte, daß er sonst ohne mich Mittel und Wege finden würde, die Angelegenheit durchzuführen, war er doch ebenso eigensinnig wie gutmütig, wenn es sich um etwas handelte, an das er sein Herz gehängt hatte. Und fremde Unterhändler würden sicher nicht verfehlt haben, das Ganze so oder so zu einem ungeheueren Skandal auszugestalten, was unter allen Umständen vermieden werden mußte. Das ewige Lavieren zwischen dem starrköpfigen Maharadscha und der nicht weniger dickköpfigen Regierung in Kalkutta erforderte oftmals mehr als Geduld und kluge Biegsamkeit.
Ich eröffnete also an einem der nächsten Tage die Verhandlungen mit den Eltern. Der Schweizer Fremdenführer hatte anscheinend schon vorgearbeitet und den guten Leuten den Reichtum des Maharadscha als unermeßlich, unfaßbar geschildert.
Ich war daher innerlich hocherfreut, als Papa Delgado mit fester Stimme als Grundlage jeder Verhandlung die für ihn sicherlich unvorstellbare Summe von zweimal hunderttausend Pesetas verlangte. Mama Delgado stimmte stürmisch zu, und die beiden Mädchen starrten mit glänzenden und erwartungsvollen Augen mir auf den Mund.
„Zweihunderttausend Pesetas! Docientas mil pesetas!“ wiederholten die Eltern, sich gegenseitig anfeuernd.
Nun war es bei der Finanzlage des Maharadscha und bei den großen Auslagen, die er zurzeit hatte und noch längere Zeit hindurch haben würde, ganz ausgeschlossen, daß diese Summe gezahlt werden konnte. Daher meine Freude. Mit aller Diplomatie suchte ich zwar „den Preis zu drücken“, wobei ich aber vorsichtig war, nicht zu weit zu gehen, denn mir lag gerade daran, daß die Leute hartnäckig bei ihrer Forderung blieben. Darin unterstützte[S. 70] sie der Schweizer Fremdenführer auf das eifrigste und ein dritter Mann, Carlo, der sich als Bräutigam Anitas einführte und plötzlich auf der Bildfläche erschien, komplizierte die Sache noch mehr, indem er mit rachedrohenden, feurigen Blicken dem Maharadscha Schrecken einjagte. Diese Verhandlungen nämlich zogen sich lange hin, wurden an den unmöglichsten Orten, im Kaffeehaus, im Kursaal-Varieté, im Restaurant geführt. Stets war Anita zugegen, und ihr Anblick stachelte immer aufs neue die Leidenschaft Dschagatdschit Singhs an. Ihre Blicke verrieten nur zu deutlich, wie gern sie „die Lieblingsfrau des Maharadscha“ geworden wäre.
Doch, docientas mil pesetas! Unmöglich!
Unter dem Zwange dieses Unmöglich und auch etwas infolge der drohenden Blicke des heißblütigen Carlo wurden endlich zu meiner großen Erleichterung die Verhandlungen abgebrochen, und wir kehrten nach Paris zurück.
Doch Anitas Bild verließ Dschagatdschit Singh nicht. Nichts als „sie, die Einzige“, sie, die die Wünsche seiner Träume oder die Träume seiner Wünsche erfüllte, wie er ständig wiederholte, gab es noch auf dieser Erde!
Umsonst kam ich immer wieder auf meine Darlegungen der politischen Seite der Angelegenheit zurück; umsonst wies ich auf die mißliche Lage der Finanzen hin; umsonst auf die Unmöglichkeit, sich mit einer nur spanisch sprechenden Tänzerin zu verständigen, — nichts half. Anita mußte gekauft werden, aber wie? von was? woher die docientas mil pesetas nehmen?! Selbst zur Beschaffung der Hälfte der Summe mußte ich einige Geschäfte durchführen, an die ich nur mit dem größten Unwillen herangehen mochte. Und ich wußte auch, wie die Regierung dachte.
Entweder konnte ich einige Liegenschaften auf britischem Gebiet verkaufen, oder einen Teil der alten Staatsjuwelen der „Toscha Kana“. Für die letzteren lag schon ein Angebot der Firma Hamilton & Co. in Kalkutta vor, die mir mitgeteilt hatte, daß sie[S. 71] eine ziemlich bedeutende Summe zu zahlen bereit sei. Ob sie dabei ein gutes Geschäft machen würde, war ihre Sache. Die „Toscha Kana“ von Kapurthala war nicht die von Baroda, und ich wußte, daß unter den Gegenständen, die die Schatzkammer füllten, manches Unechte und Minderwertige sich befand, und daß selbst von den großen Smaragden nur sehr wenige fehlerfrei waren. Doch immerhin, das Geld war gut und konnte den finanziellen Horizont etwas klären.
Bei den Liegenschaften handelte es sich in erster Linie um zwei Gebäude von historischer Bedeutung. Das eine war ein Haus in Lucknow, das schon mehr Schloß genannt zu werden verdiente. Es war früher ein Gartenpalast der Könige von Oudh gewesen und hieß „Luxmi Bagh“, Garten des Glückes.
Um dieses Gebäude hatte der Kampf der englischen Truppen mit den Aufständischen 1857/58 am heftigsten getobt. Als die Generale Havelock und Cutram zum Entsatz von Lucknow herbeieilten, war es ihr erstes gewesen, diesen starken Stützpunkt zu stürmen. Hierbei hatte sich der Großvater Dschagatdschit Singhs, der Radscha Ranghir Singh, mit seinem Truppenkontingent besonders hervorgetan, wofür ihm die anglo-indische Regierung das Schloß schenkte.
Das andere Haus lag in Lahaur. Sein Garten umschloß das Grabdenkmal des französischen Generals Lacroix, der die Sikh-Armee, die unter dem berühmten Maharadscha Radschit Singh, dem „Löwen des Pundschab“, kämpfte, ausgebildet hat. Es war dem Urgroßvater Dschagatdschit Singhs, dem Sirdar Nehal Singh, von dem damaligen König des Pundschab geschenkt worden und hieß „Kuschi Bagh“, Garten der Zufriedenheit.
Käufer für diese verschiedenen Häuser zu finden, wäre nicht schwer gewesen, doch der britische Sirkar hätte dabei erwartet, als Ausdruck der Ergebenheit des Maharadscha ebenfalls mit einem Gebäude, das als Kaserne, als Krankenhaus oder als Beamtenwohnung dienen konnte, bedacht zu werden. Sehr wahrscheinlich aber hätte die Regierung diese Häuser nicht aus dem[S. 72] Auge und der Hand gelassen, so daß nicht viel mehr herausgesprungen wäre, als die Zuerkennung von einer erhöhten Zahl Kanonenschüsse im Salut, die den indischen Fürsten je nach ihrem Range zustehen und die der Zahl nach von dem britischen Vizekönig verliehen werden.
Alle diese Dinge waren auch dem Maharadscha bekannt. Doch seine Sehnsucht nach Anita verzehrte ihn zu heftig, als daß er meinen Bedenken Gehör geschenkt hätte. Dann kam ein französisch abgefaßter Brief der Gitana. Sie teilte darin mit: der Maharadscha solle sich nicht um die Äußerungen des Vaters Delgado kümmern. Sie werde mit ihm, ebenso wie mit Carlo, der kein Recht habe, sich ihren Bräutigam zu nennen, fertig werden. Nur solle der Schweizer Fremdenführer aufhören, ihren Eltern den Kopf zu verdrehen. Wenn Seine Hoheit sich ihrer annehmen wolle, so möge er am besten den europäischen „capitano“ senden, der sicher der Mann sei, die Angelegenheit zu einem guten Ende zu führen. Mit dem „capitano“ meinte sie mich.
Nun gab es für den Maharadscha kein Halten mehr. Kein Hinweis, keine Bitten, keine Drohung mit der Mißgunst der Regierung halfen. Ohne seine „Lotosblume“ könne er nicht weiter leben, und ich mußte mich von neuem auf den Weg nach Madrid machen, die schöne Gitana zu „erwerben“.
Mit heller Freude wurde ich von den Schwestern und der Mutter begrüßt, als ich sie in ihrer Wohnung in einem der abgelegenen Viertel der Stadt aufsuchte. Der Vater war nicht anwesend. Nur Carlo warf mir wütende Blicke zu.
Der Maharadscha hatte mir bis zu hunderttausend Pesetas freie Hand gelassen. Doch auch das war mir viel zu viel. Wir brauchten das Geld nötiger für andere Zwecke. Ich hörte die Klagen der Mutter, die stürmischen Bitten der Schwestern und die schon jetzt auf Entschädigung zielenden Äußerungen Carlos geduldig mit an und bot am vierten Tage — fünfundzwanzigtausend Pesetas, die überwiesen werden sollten, sobald Anita in Paris eingetroffen sei.
[S. 73]
Ich hatte auf eine glatte Ablehnung gehofft. Doch der Sturm der Klagen und Bitten verstummte. Mama Delgado war einverstanden. Sie machte nur zwei Bedingungen: erstens müsse Vittoria ihre Schwester begleiten und zweitens müsse man sie selbst mit nach Paris nehmen. Denn als liebende Mutter der teuren Töchter wolle sie sich überzeugen, wie sie untergebracht würden.
Auf meine Mitteilung dieses „Abschlusses“ gab der Maharadscha, der in den Tagen der Verhandlungen Anita mit Telegrammen bestürmt hatte, umgehend und telegraphisch seine Zustimmung, und ich reiste, begleitet von den drei Damen, nicht ohne sie vorher noch in entsprechende Gewandung gesteckt zu haben, mit dem Süd-Expreß nach Paris.
Hätte ich damals gewußt, wie Anita sich entwickeln und welch guten Einfluß sie auf den Maharadscha ausüben werde, mir wären viele Sorgen und manche schlaflose Nacht erspart geblieben!
Auf dem Orleans-Bahnhof in der französischen Hauptstadt empfing uns der persönliche Adjutant des Maharadscha, Leutnant Tschatterdschie, allein, ohne Dschagatdschit Singh! Anita tobte vor Entrüstung. Kaum konnte ich sie zum Verlassen des Bahnsteiges überreden. In einem Hotel dritten Ranges waren Zimmer für die Damen Delgado genommen. Dies steigerte den Zorn der schönen Gitana ins Maßlose. Sie brach in Tränen aus, verwünschte sich, mich, den Maharadscha und die ganze Welt und erklärte, lieber ginge sie zu Fuß nach Madrid zurück als hier zu bleiben.
Der Grund der Abwesenheit des Maharadscha bei der Ankunft war ein Fest, das der Prinz de Broglie ihm zu Ehren gab und wo er nicht gut durch Abwesenheit glänzen konnte. Doch damals war Anita das Triftige dieser Abhaltung noch ganz unverständlich. Ihre Entrüstung und ihre Verzweiflung waren so ernst, daß ich dem Maharadscha sofort Nachricht zukommen ließ, der, eine plötzliche Erkrankung der Maharani vorschützend, umgehend das Fest verließ und nach dem Hotel Ritz, wo er wohnte, zurückkehrte. Dort möge, ließ er mir mitteilen, Anita ihn im Salon[S. 74] erwarten. Nur mit Schwierigkeit gelang es endlich der Mutter, die um ihre 25000 Pesetas besorgt war, Anita zu bewegen, mir in das Hotel Ritz zu folgen. Der Maharadscha erwartete sie, angetan mit allen seinen Orden, vom Kapurthala-Hausorden bis zum Stern von Indien, und am Turban ein großes Diamanten-Diadem, um Anita von seiner Würde zu überzeugen.
Doch auf die schöne Gitana machte das alles keinen Eindruck. Stolz, hochmütig warf sie dem Maharadscha einen vernichtenden Blick zu und begann dann, sich auf das heftigste über die Rücksichtslosigkeit und Nachlässigkeit des Empfanges zu beklagen. In seiner Verlegenheit zog der Maharadscha einen Diamantring vom Finger und überreichte ihn ihr. Ohne ein Wort des Dankes steckte sie ihn an und setzte sich dem Maharadscha gegenüber.
Mit den wenigen Brocken Spanisch, die ich mir angeeignet hatte, und den noch geringeren französischen Kenntnissen Anitas war es schwer, eine Unterhaltung in Gang zu bringen. Am nächsten Tage sollte sie in das Ritzhotel übersiedeln, und ihrer Mutter sollte der übereingekommene Kaufpreis ausgezahlt werden.
Ihre Schwester Vittoria hatte sie begleitet. Als ich nach einer von Anitas Seite noch immer recht kühlen Verabschiedung von dem Maharadscha mit den beiden Mädchen das Hotel verlassen wollte, trafen wir zufälligerweise mit dem amerikanischen Multimillionär Thaw und seinem Freunde Wynands zusammen. Von der Schönheit der beiden Gitanas überrascht, traten sie auf mich, der ich sie oberflächlich kannte, zu, und baten vorgestellt zu werden.
Am nächsten Morgen erschien Mama Delgado in Begleitung ihrer beiden Töchter, von mir abgeholt, im Hotel. Der Maharadscha saß in seiner ganzen Würde in einem Klubsessel und hielt einen dicken Briefumschlag mit den 25000 Pesetas, gleich 20700 Franken, in der Rechten. Der Adjutant hatte, der indischen Sitte gemäß, ein Dokument aufgesetzt, das in der Übersetzung besagte:
Cardelassia Bajosse,
Señora Delgado.
Paris, am 16. Juni 1906.
Während der Zeit, daß meine Tochter Anita bei Seiner Hoheit bleibt, wird sie monatlich 2000 Pesetas für ihre persönlichen Ausgaben erhalten.“
Mach tränenvollem Abschied verschwanden die Señora Delgado und Señorita Vittoria, die eine, um mit dem Kaufgeld nach Madrid zurückzukehren, die andere, um ihre Laufbahn als Tänzerin in Paris zu beginnen, wo ich ihr auf einer bekannten Bühne durch deren mir befreundeten Direktor eine Stellung verschafft hatte. Dort traf sie der ihr von mir vorgestellte Amerikaner Wynands, der nichts Eiligeres zu tun hatte, als sie zu heiraten. Zwar enterbte ihn promptest sein millionenreicher Vater in Baltimore. Doch ein Oheim des jungen Mannes in London nahm sich seiner an. In der Folgezeit gelang es auch dem bescheidenen und liebenswürdigen Wesen der jungen Frau, das Herz ihres Schwiegervaters zu gewinnen und so die in Hast und Zorn getroffene Enterbung rückgängig zu machen.
Anita bezog ihre Wohnung im Ritzhotel, die an unsere Zimmer stieß. Die nächsten Tage vergingen mit Einkäufen. Trotz aller Mahnung zur Sparsamkeit überhäufte Dschagatdschit Singh sie, seine „Lotosblume“, mit Geschenken. Sie selbst aber war und blieb vorsichtig und äußerst zurückhaltend. Noch am Tage des Kaufabschlusses suchte sie einen Juwelier auf, um sich überzeugen zu lassen, daß der ihr am Abend vorher geschenkte Ring auch echt sei, trotzdem ich ihr versichert hatte, er sei wenigstens fünftausend Franken wert.
Bald nach dem Ende der Pariser Saison mußte der Maharadscha nach London, um dort seine Staatsbesuche zu machen. Die Maharani und die Rani Barbotti sollten zunächst über die Existenz Anitas nichts erfahren, was natürlich nicht durchführbar[S. 76] war, denn die Söhne kamen ständig von ihren Schulen zu kurzen Besuchen nach Paris und liebten es, ihren Vater zu überraschen. Dabei traf denn auch eines Tages der junge Tika Sahib, der Sohn der Maharani und Thronfolger, mit Anita zusammen, wodurch die ganze Angelegenheit an den Tag kam.
Nach kurzem Aufenthalt in London siedelte der Haushalt des Maharadscha nach Puys in der Nähe von Dieppe über, während Dschagatdschit Singh mit Anita in Dieppe selbst Wohnung nahm. Trotz allen Sträubens der Maharani und der Rani Barbotti ruhte der Maharadscha nicht, bis er Anita ihnen vorstellen konnte. Mit Tika Sahib wurde sie bald gut Freund. Ihr Besuch bei den beiden Damen der Zenana war für Anita mit ganz bestimmten Absichten verbunden, wie sie denn nichts ohne reifliche Überlegung tat und ohne sicher zu sein, daß ein jeder solcher Schritt auch für ihre Zukunft von Bedeutung war.
Noch vor der Abreise nach Kapurthala konnte sie dem Maharadscha mitteilen, daß sie ihm ein Kind schenken werde. Sie war stolz und glücklich, die Mutter eines „Prinzen“ zu werden, und er glücklich und stolz, einen „weißen“ Sohn erhoffen zu dürfen. Natürlich war jetzt nicht mehr daran zu denken, daß sie Dschagatdschit Singh in diesem Jahre nach Kapurthala begleiten könne.
Nach einem schönen, in Baden-Baden verlebten Herbste wurde Anita bei dem Pariser Agenten des Maharadscha einquartiert, und Dschagatdschit Singh trat schweren Herzens die Heimreise nach Indien an.
In Kapurthala war die ganze Angelegenheit schon bei unserer Ankunft Bazargespräch. Durch ihren Sohn, der in Rouen zur Schule ging, war die Rani Kanari auf das Genaueste unterrichtet. Alle Zenanadamen schlossen sich zu einer Intriguenfront zusammen, um die Weiße zu verdrängen. Doch nichts konnte den Maharadscha seiner geliebten Lotosblume abtrünnig machen. Selbst wenn es ihm Rang und Titel kosten sollte, von ihr würde er sich niemals trennen!, erklärte er mir bestimmt.
[S. 77]
Und der Einfluß Anitas, der schon in Dieppe und in Baden-Baden sein äußeres Benehmen europäischer gemacht hatte, was sich besonders in seinen Tischmanieren zeigte, die früher noch recht indisch gewesen waren, hielt sogar in Kapurthala vor. Die herrlichen Wintermonate gingen ohne die sonst üblichen rauschenden Festlichkeiten vorüber. Kaum daß er hin und wieder einige Einladungen versandte. Und von der früher so hochgeschätzten Aristokratie mochte in Bombay landen, wer wollte; er trug kein Verlangen, sich in seinem Schloß Kapurthala stören zu lassen. Seine einzige Sorge war der pünktliche Eingang der wöchentlichen Post aus Europa und die Nachrichten, die er über Anitas Befinden erhielt. Endlich kam die Mitteilung, daß ihn ein — wohl nahezu weißer — Sohn in Paris erwarte — und sofort war er von neuem nach dort unterwegs.
Diesmal stellte er sogar mich zur Disposition. Ich erhielt sechs Monate Urlaub, in dessen Verlauf ich ihn in Paris besuchte. Anita empfing mich so freudestrahlend, daß der Maharadscha sich zurückgesetzt fühlte und bemerkte, sie scheine sich mehr zu freuen, mich wiederzusehen, als ihn selbst. Auch zu dem Jungen konnte ich beide nur beglückwünschen, denn er war wirklich von einer auffallend hellen Hautfarbe.
Immerhin, ich kürzte meinen Besuch soviel wie möglich ab und traf auch an den anderen Orten, wo sie sich späterhin aufhielten, nur vorübergehend ein.
Dabei fiel mir auf, daß der Maharadscha Anita als Rani von Kapurthala betitelte, und ich begann zu fürchten, daß er die Absicht habe, sie tatsächlich nach Indien mitzunehmen. Mit dem Aufwande meiner ganzen Beredsamkeit suchte ich ihn davon abzubringen, denn die möglichen Folgen erschienen mir zu unheimlich. Ganz abgesehen von der Haltung der Regierung gegenüber einem solchen Schritte, würde die Bevölkerung ihn ebenfalls nicht mit Freude begrüßt haben, und wenn auch nicht ihm, dem Maharadscha, so doch Anita Unannehmlichkeiten bereiten. Außerdem war, wie ich wohl wußte, die Haltung der anderen Zenanadamen[S. 78] so feindselig wie nur möglich, und ich fürchtete, der Haß der indischen Frauen gegen die Weiße möchte sich zu Taten hinreißen lassen, die nicht wieder gutzumachen sein würden. Im Dunkel der zahllosen Gänge und Gemächer der weitläufigen Paläste ist ein Fall mit tödlichem Ausgang leicht geschehen. Gift, schnelles und schleichendes, ist nicht so schwer zu beschaffen und noch leichter beizubringen; in den weiten Gärten sind Unfälle keine Unmöglichkeit — kurz, all die Tatsachen und die Gewißheit, daß absolut keine, außer rein äußerliche, Gründe die Familienfeindinnen Anitas davon abhalten würden, gegen sie vorzugehen, ließen mich nur mit den schwersten Bedenken den Gedanken einer Überführung der Gitana nach Indien überhaupt in Erwägung ziehen.
Doch selbst wenn aus irgendwelchen Gründen diese letzten Mittel nicht ergriffen werden sollten, so gab es an einem indischen Hofe noch tausend andere Möglichkeiten der Intrigen und geheimen Nachstellungen von so unglaublich schmutziger Art, daß ihnen ein soeben aus Europa eintreffendes weibliches Wesen unmöglich zu begegnen wissen konnte.
Anscheinend fügte sich schließlich der Maharadscha auch meinen Einwendungen, und es wurde bestimmt, daß Anita unter der Obhut meiner eigenen Frau in Europa bleiben solle. Wir reisten zurück nach Indien, und außer den Berichten meiner Frau und den Nachrichten, die der Maharadscha mir hin und wieder gab, hörte ich nichts über die Gitana, bis eines Tages Dschagatdschit Singh mir mitteilte, Anita werde in Begleitung meiner Frau mit dem Dampfer „Nera“ in einigen Tagen in Bombay eintreffen. Ich möge mich doch bereit halten, die Damen dort abzuholen!
Ich war regelrecht überrumpelt worden!
Als ich meinem Erstaunen und meinem Unwillen Ausdruck gab, beschwichtigte der Maharadscha meine Bedenken mit dem Hinweis, daß er vor der Stadt in der Villa „Buena Vista“ mit Anita wohnen werde. Auch sollten einige indische, in der Eingeborenensprache erscheinende Zeitungen gekauft werden, um in der Bevölkerung[S. 79] für Anita Stimmung zu machen. Mit der anglo-indischen Regierung würde sich schon ein modus vivendi finden lassen, wenn erst einmal die schöne Spanierin in Berührung mit den anglo-indischen Kreisen gekommen wäre. Ich solle, angeblich zum Ankauf von Pferden, nach Bombay reisen und die Damen dann nach Kapurthala bringen. Hinter meinem Rücken war also schon alles geplant und abgemacht worden! Und im übrigen: niemand könne diese schwierige Sache besser als ich durchführen, er rechne auf mich und so weiter, schloß der Maharadscha seine Beschwörung.
Doch was würden die Zenanadamen dazu sagen? Was würden sie tun? Besonders die Rani Kanari?! —
„Nichts, denn wir werden in der Villa wohnen“, antwortete der Maharadscha auf alle Einwendungen, als ob das irgendein Hemmnis für die möglichen Anschläge gewesen wäre.
Nein, ich fürchtete die unausbleiblichen Folgen, die schlimmsten Überraschungen, und bat den Maharadscha um meine Entlassung. Den Intrigen, die jetzt sicher einsetzen würden, sah ich mich nicht gewachsen. In Europa würde ich gern jederzeit zu seiner Verfügung stehen. Doch auf alles, was ich vorbrachte, antwortete er nur, daß, solange er regiere, an meinen Abschied nicht zu denken sei.
Das nahm mir meine Sorgen nicht, und mit sehr gemischten Gefühlen ging ich daran, meinen Auftrag auszuführen.
Ich fuhr nach Bombay und nahm Anita, von meiner Frau begleitet, in Empfang. Als die Damen wieder festen Boden unter den Füßen fühlten, waren sie sehr zufrieden. Doch das dauerte nicht lange. Ich hatte, um Aufsehen zu vermeiden, Zimmer im Apollo-Hotel genommen. Das erste Hotel in Bombay aber ist das Tadsch-Mahal-Hotel. Das war sofort ein Grund zu Klagen. Für Anita gab es kein größeres Vergehen, als ihre Schönheit zu verdecken, um so mehr als sie sich jetzt schon als Prinzessin fühlte.
Die Tage des Aufenthalts in Bombay wurden mit der Besichtigung[S. 80] der großen Kaufläden ausgefüllt, und trotz der langen, ständig eintreffenden Telegramme des Maharadscha ließ sich Anita nicht bewegen, eher abzureisen, als bis sie alles besichtigt hatte, was Bombay an Damenausstattungsgeschäften besitzt. Endlich reiste man ab. Nicht im Kapurthala-Staats-Salonwagen — aus guten Gründen —, sondern einfach in einem Spezial-Salonwagen erster Klasse. Zweite Entrüstung!
Das Gesicht, mit dem sie den zum Bahnhof Kapurthalas, Kartapur, ihr entgegengeeilten Maharadscha empfing, war auch danach. Sie begann sofort, ihm alles vorzuwerfen, was sie auf der Reise erduldet hatte.
Nachdem sie den begleitenden Adjutanten Lala Schiv Narain sehr scharf gemustert hatte, nahm sie in dem Kraftwagen Platz, der sie nach der Villa „Buena Vista“ brachte.
Mit welcher Sorge sah ich der Zukunft entgegen! Und doch, wie hatte ich mich getäuscht! Zwanzig Jahre Indien, zwanzig Jahre, die ständig in dem Ränkespiel eines indischen Hinduhofes verbracht worden waren, hatten meinen Blick für die gleichen Eigenschaften einer spanischen Gitana getrübt. Für mich war sie die Vertreterin europäischer Grundbegriffe, europäischer Moral, europäischer Ethik, welche gegen die Hinterlist, Tücke und die Skrupellosigkeit, wie sie in den verborgenen Gemächern der Zenana in höchster Vollendung sich auslebt, waffenlos war. Ich hatte eins übersehen: daß Anita als Gitana, als Zigeunerin, trotz ihres Geburtsortes Malaga, indische Instinkte besitzen mochte, stammen doch die Zigeuner aus dem Lande des Ganges. Sie zeigte sich ihren Widersachern mehr als gewachsen und verlor keine Sekunde, zum Angriff überzugehen.


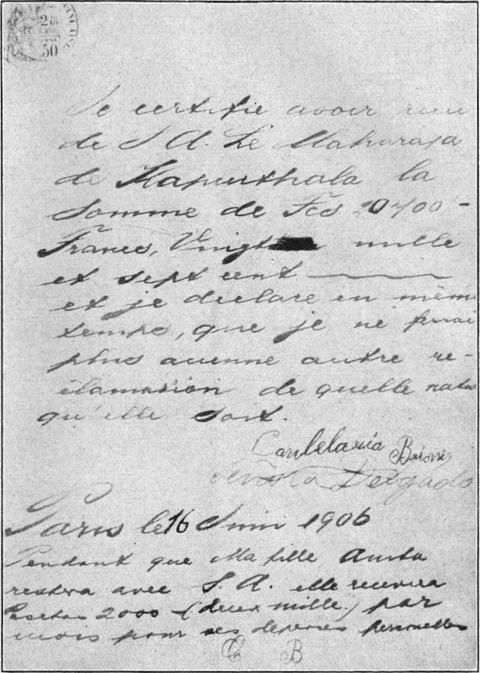
Sie hatte es verstanden, sich vor ihrer Ankunft auf das Genaueste mit den Verhältnissen in Kapurthala vertraut zu machen. So war ihr auch mitgeteilt worden, daß die Rani Kanari in den Armen eines Adjutanten des Maharadscha Trost für die Vernachlässigung seitens ihres Herrn und Gebieters suche. Dieser Adjutant war ihr nach Gesicht und Ansehen genau beschrieben worden,[S. 81] und in Lala Schiv Narain, der mit Dschagatdschit Singh zu ihrem Empfang auf dem Bahnhof erschienen war, erkannte sie sofort den angeblichen Liebhaber der Rani Kanari. Während der Fahrt nach der Villa machte sie daher schon dem Maharadscha die heftigsten Vorwürfe, daß er gewagt habe, sie in Begleitung des Geliebten seiner Frau zu empfangen, und verlangte kategorisch, daß er sich vollständig von der Rani Kanari zurückzöge, was der im Besitz seiner „Lotosblume“ froh erregte Dschagatdschit Singh ohne weiteres zusagte.
Um nun ihre Stellung der Außenwelt gegenüber so fest wie möglich zu machen, kam dem Maharadscha der Gedanke, Anita zu überreden, zum Hinduglauben überzutreten.
Er hatte erwartet, großen Widerstand zu finden. Aber Anita übersah blitzschnell die Lage und die Vorteile, die ihr dies hinsichtlich der Zenanadamen bot. Ohne Besinnen willigte sie ein.
An und für sich ist ein Übertritt vom Christentum zum Heidentum des Hinduismus nicht möglich. Doch Dschagatdschit Singh als Maharadscha und unbeschränkter Gebieter konnte in einem so außergewöhnlichen Falle die Zeremonien von einem willfährigen Priester durchführen lassen.
Das Verhalten Anitas war mir ein Rätsel. Wo hinaus konnten ihre Pläne zielen? Welche Absichten verfolgte sie? Daß sie viel verschlagener war, als ich früher angenommen hatte, schien mir sicher. Ihr Entschluß, als spanische Katholikin zum Heidentum überzutreten, veranlaßte selbst meine Frau, die soweit stets zu ihr gehalten hatte und streng der allein seligmachenden Kirche anhing, sich von ihr zu lösen, wozu auch der Druck beitrug, den die anderen Zenanafrauen auf sie ausübten, und die von ihr eine Entscheidung forderten, entweder zu ihnen zu halten oder bei der Fremden zu bleiben und die Folgen zu tragen.
Die Vorbereitungen zu dem Übertritt, der hochoffiziell und mit einem Fest verbunden vor sich gehen sollte, wurden in die Wege geleitet. Doch Anita war auf ihrer Hut und unterließ nichts, ihre Stellung zu festigen. So gelang es ihr sogar, den erst als Liebhaber[S. 82] der Rani Kanari verdächtigten Lala Schiv Narain auf ihre Seite zu ziehen und ihn zum willfährigen Sklaven ihrer Befehle zu machen.
Um auch bei den englischen Besuchern Eindruck zu erwecken, nannte sie sich mit Zustimmung des Maharadscha „geb. Baronin Anita Del Gado de Malaga“ und gab vor, von einer Familie zu stammen, die in den Kreuzzügen und Maurenkriegen ihre Besitztümer verloren hatte. Der Kursaal von Madrid war ihrem Gedächtnis ganz entschwunden. Nur eins vergaß sie nicht: daß nämlich außer dem Maharadscha auch ich von den näheren Umständen Kenntnis hatte, die sie mit Dschagatdschit Singh zusammengebracht hatten. Dies mußte auch der Grund sein, weshalb sie mir immer schärfer entgegentrat. Ich verhielt mich trotzdem vollständig zurückhaltend, ohne aber zu verfehlen, ihr in jeder Weise, auch in den kleinen Dingen, zu Diensten zu sein, ihr stets tadellose Pferde, beflissene Diener zu stellen und all die Angelegenheiten in ihrem Interesse zu ordnen, in die an einem indischen Hofe so viel Möglichkeiten zu Verdruß, zu Ärger, ja zu persönlichen Gefahren von einer geschickten Hand gemischt werden können. Doch all dies schien ihr zu entgehen. Ich beschloß daher, mich auf das äußerste zusammenzunehmen. Hier in Indien haben nicht nur die Wände und Türen, sondern die Luft und jeder, selbst der harmloseste Gegenstand, Augen und Ohren.
Immer näher kam der Tag des Übertritts. Immer augenfälliger wurde Lala Schiv Narain ihr ergebener Diener, und selbst Tschatterdschie, der bengalische Leutnant, der den Kaufvertrag mit ihrer Mutter aufgesetzt hatte, begann ganz auf ihrer Seite zu stehen.
Die Rani Kanari schloß sich in ihre Gemächer ein und brütete über Racheplänen. Doch ein Werkzeug nach dem anderen schien ihr zu entgleiten, um sich der Nebenbuhlerin gegenüber behaupten zu können. Sicherlich wollte sie Anita verderben, durch Gift oder Unfall beseitigen. Aber ihr Sturz nahm ihr alle Freunde und muß[S. 83] sie so einsam gemacht haben, daß sie rein praktisch den Racheakt nicht mehr auszuführen vermochte. Vielleicht hatte ihre Trunksucht auch ihren Willen so geschwächt, daß sie über dem Ersinnen ihrer Vernichtungspläne nicht mehr die Kraft zur Durchführung aufbrachte. Immer mehr und zum Schluß ganz schrankenlos ergab das unglückliche Wesen sich dem Kognak, so daß ihr einst so schöner Körper die verbitterte, vereinsamte, verzweifelte Seele nicht mehr zu halten vermochte. Nach kurzen Monaten erlöste sie der Tod, und ihre Asche wurde den schmutzigen Wellen des heiligen Ganges übergeben.
Mit den kostbarsten Saris — Seidenschals — und anderen Bekleidungsstücken aus der Garderobe der damals noch lebenden Rani Kanari wurde, ohne Rücksicht auf die Gefühle der einstigen Lieblingsfrau, Anita zur Feier ihres Übertrittes zum Heidentum bekleidet.
Zahlloses Publikum, Neugierige, Bekannte und eingeladene Freunde waren herzugeeilt. Ein ähnliches Ereignis hatte das Kaiserreich Indien noch nicht gesehen.
Die eigentliche Zeremonie fand in einem kleinen Zeltlager statt, das nahe der Villa aufgeschlagen worden war. Der Maharadscha erschien in seiner Nationaltracht, um dem Fest den höchsten Glanz der Würde zu verleihen. Anita war in Schals und Schleier gehüllt, die die graziösen Bewegungen ihrer Figur nur noch eindrucksvoller, gefälliger machten.
Der Altar des amtierenden Priesters war in der Schamiana, einem viereckigen Zelt mit flachem Dach, errichtet und war nicht mehr als ein kleines niederes Pult, hinter das ein großes, weißes Kissen für den Pandit Guru, den hohen Sikhpriester, der die Handlung vornahm, gelegt war. Zwei andere Kissen für den Maharadscha und Anita befanden sich ebenfalls dort. Den ganzen Boden bedeckte ein völlig weißer Teppich.
Als Dschagatdschit Sing und die Gitana mit untergeschlagenen Beinen vor dem Altar Platz genommen hatten, murmelte der Priester, von einem anderen assistiert, einige Sprüche. Sodann[S. 84] schlug er aufs Geratewohl ein etwa faustdickes Buch, die Guru-Bibel, auf und verkündete aus ihr den Sikhnamen: „Umedi“, den Anita fernerhin tragen sollte. Aufstehend tauchte er den Zeigefinger in eine Schale mit rötlicher Flüssigkeit und malte ihr ein Zeichen auf die Stirn, wobei er laut ausrief, daß sie nun der unvergleichlichen Kaste der Kahlsa Sikh angehöre.
Anita zeigte keine Spur von irgendwelcher Erregung. Sie schien niemals etwas anderes erwartet zu haben. Mich aber bedrückte die Frage, weshalb sie wohl auf diese ganze Komödie eingegangen sei?
Nachdem der Guru sich wieder auf sein Kissen niedergelassen hatte, schlug er eine neue Seite des Buches auf und fand, was notwendig war, um die Rani Umedi auch nach Sikhrecht zur Gemahlin des Maharadscha zu machen. Gefolgt von seinem Assistenten, umwand er beide mit einem langen Jasminblütenband, worauf der zweite Priester sie von dieser leichten Fessel wieder befreite, was die Erreichung der höchsten Gnade der Hindugötter andeuten sollte.
Damit war die Feier vorüber, und der Maharadscha mit der neuen Hindu-Rani Umedi verließ mit den Gästen das Zelt. Ein paar Reden, einige Glückwünsche, und der offizielle Teil der Feier war beendet.
Als ich mich am nächsten Tage meiner Gewohnheit gemäß zum Maharadscha begab, fand ich ihn mit Anita beim Frühstück. Beide außergewöhnlich verstimmt. In verbissener Schweigsamkeit saßen sie sich gegenüber. Als die Rani Umedi mich gewahr wurde, stand sie auf und verließ das Zimmer, die Türe hinter sich ins Schloß werfend. Fragend sah ich den Maharadscha an. Er bat mich in sein Arbeitszimmer. Gespannt auf das, was ich hören würde, und was mir vielleicht den Schlüssel zu Anitas eigentümlichem Verhalten mir gegenüber geben konnte, folgte ich ihm. Kaum eingetreten, schloß der Maharadscha die Tür und erzählte mir mit allen Zeichen der heftigsten Erregung, daß die Rani Umedi geradezu Unmögliches verlange.
[S. 85]
Sie habe ihm erklärt, daß, da sie jetzt auch nach den Lehren der Hindu und den Kastenvorschriften der Sikh seine rechtmäßige Gattin sei, sie darauf bestände, sofort in den Palast zu Kapurthala überzusiedeln. Aber allein wünsche sie dort zu sein! Die Maharani und die anderen Rani wären umgehend zu entfernen. Ganz besonders schnell die Rani Kanari. Von jetzt ab gäbe es nur eine gesetzmäßige Gemahlin und Königin von Kapurthala, und das sei sie selbst!
Als er ihr klarzumachen versucht habe, daß ihr Verlangen Unmögliches fordere, habe sie zu immer heftigeren Ausdrücken gegriffen, so daß zuletzt ein Wortwechsel entstanden sei, der seinen Zorn so weit gesteigert habe, daß er ihr vorwarf: sie habe wohl die Erinnerung an ihre Herkunft vergessen!; ob sie nicht mehr wisse, für welch lächerliche Summe er sie von ihrer Mutter erstanden habe? Obgleich der „capitano“ freie Hand bis zu hunderttausend Pesetas gehabt habe, seien ihre Eltern froh gewesen, sie für 25000 loszuwerden.
Dieses dem Maharadscha entschlüpfte Geheimnis, daß ich nur den vierten Teil für Anita bezahlt hatte, den er auszulegen bereit gewesen wäre, und dies nicht zu meinem eigenen, sondern zum Vorteil Dschagatdschit Singhs, mußte, das wurde mir sofort klar, den äußersten Haß der Gitana herausfordern. Schon war ich ihr ein Dorn im Auge wegen meiner Kenntnis ihrer Herkunft überhaupt. Jetzt noch zu wissen, daß ich das Interesse der Börse des Fürsten ihrem eigenen vorangestellt hatte und dies gegebenenfalls auch verraten könne, würde sie zu den gewagtesten Schritten verleiten, um mich zu entfernen. Wenn ich so auf der einen Seite mit der unversöhnlichen Feindschaft der Rani Umedi zu rechnen hatte, so standen auf der anderen auch alle Zenanadamen geschlossen gegen mich. Die Lage war unhaltbar.
Sofort wies ich den Maharadscha darauf hin. Er war es gewesen, der in so törichter Weise nicht wieder zurückzunehmende Vorwürfe gemacht habe. Er müsse mich entlassen. Doch wiederum[S. 86] ging er nicht auf meinen Vorschlag ein. Alles dies, sagte er, sei nichts als ein Ränkespiel. Er werde schon mit den Rädelsführern fertig werden. Die ganze Sache fing an, ihm auf die Nerven zu fallen. Ich solle unbesorgt sein, er werde schon alles in Ordnung bringen. Ohne mich usw., usw.
Ich konnte dem Maharadscha meine Entlassung nicht abzwingen. Aber ich vertraute ihm wenig. Stand er doch ganz unter dem Einfluß der Rani Umedi! Lag doch unweit von uns die unglückselige Rani Kanari, an deren langsamem Untergang er so große Schuld trug, allein, verlassen, verhöhnt und ohnmächtig, auf ihren schlimmsten Feind, den Alkohol, als einzigen Tröster angewiesen! Und daß die Rani Umedi ihre Macht und ihre Verschlagenheit rücksichtslos gegen mich ausspielen werde, konnte keinem Zweifel unterliegen.
Wohl war ich die Vorsicht selbst. Jede Speise ließ ich vorkosten. Ich bestieg kein Pferd, ohne Gurte und Schnallen genau nachzusehen. Ich trat durch keine Türe, ohne jemanden vorauszusenden, ritt unter keinem Balkon, auf dem Gefahren lauern konnten, legte mich nie schlafen, ohne Bett und Zimmer vorsorglich und gründlich abgesucht zu haben.
Und der ahnungslose Maharadscha äußerte immer wieder vor den Ohren Anitas, daß mein Scheiden von seinem Hofe eine Unmöglichkeit sei!
Als die Rani Kanari gestorben war, ließ auch die Liebenswürdigkeit Anitas gegen Lala Schiv Narain sofort nach und nahm sehr bald ganz andere Formen an, die den Armen so mit Furcht erfüllten, daß er um sein Leben sorgte. Nach ganz kurzer Zeit kam er um seine Entlassung ein und eilte, sich in den Bergen seiner Heimat Kaschmir in Sicherheit zu bringen.
Und Anita siegte. Sie bezog als alleinige Herrscherin das Schloß zu Kapurthala. Die Damen der Zenana mußten das Feld räumen und wurden in der Villa zu Mussoorie untergebracht. Als der Bezirks-Gouverneur dem Maharadscha seinen offiziellen Besuch machte, und die Rani Umedi den Damen der höheren[S. 87] englischen Gesellschaft vorgestellt wurde, gab es nur eine Stimme des Lobes. Ihrem würdigen Benehmen und ihrer distinguierten Haltung nach schien sie für die Stellung einer Prinzessin geboren. Und wenn deshalb der Maharadscha in den Augen seiner englischen Gäste auch weiter nur der „dreckige Neger“ blieb, so erfüllte ihn die Bewunderung, die der Rani Umedi gezollt wurde, doch mit der höchsten Genugtuung, worauf die verschlagene Gitana sicher gerechnet hatte.
Jedoch mich schien unerklärliches Unglück zu verfolgen. Bald hintereinander gingen zwei Rennpferde ein, auf die ich große Hoffnungen gesetzt hatte. Mehrere meiner Lieblingshunde verendeten. Nur Gift konnte die Ursache sein. Nie aber konnte ich entdecken, wessen Hand dabei im Spiele gewesen war. Dann brannten große Heuschober ab, und kurz darauf brach in der Futterkammer des Marstalls Feuer aus.
Alles dies gehörte zu meinem besonderen und Lieblings-Machtbereich. Denn außer der Aufsicht über die Paläste, unterstand mir das Gestüt, der Rennstall, die Jagd und die Elefanten und alles Getier, das zur Jagd in Indien gebraucht wird. Ich verdoppelte meine Wachsamkeit, trotzdem ich wußte, daß ich gegen die Ränke der Rani Umedi, gegen ihre Hindu-Helfershelfer nichts ausrichten konnte.
Erst wenn ich mundtot gemacht, beseitigt war, brauchte sie nicht mehr zu befürchten, daß das Geheimnis ihrer Herkunft und die Einzelheiten ihrer Erwerbung für den Maharadscha bekannt werden könnten.
Und der Maharadscha, der immer wieder darauf hinwies, daß ich ihm in Kapurthala unentbehrlich sei!
Von meinem Morgenritt zurückkommend, der mich über die Rennbahn nach den Gestüten und durch den Marstall führte, war es meine Gewohnheit, ein Glas eisgekühlten, schwarzen Kaffee zu trinken, das stets auf der Veranda meines Bungalow gegen meine Rückkehr bereitstand. Eines Morgens bemerkte ich einen etwas bitteren Geschmack, nachdem ich das Glas durstig in einem[S. 88] Zuge geleert hatte. Der Diener, der mein Reitpferd zu den Ställen führte, verschwand eben um die Hausecke. Ich will zur Schelle gehen, um meinen Kammerdiener zu rufen. Doch ehe ich noch einen Schritt tun kann, finde ich mich hilflos auf dem Boden liegen, vollständig gelähmt, doch ebenso vollständig bei Besinnung.
Ich wußte sofort, daß ich vergiftet worden sei, doch womit? Welche Wirkungen würde das Gift noch auslösen? Würde ich sterben oder nur gelähmt bleiben? Was war schlimmer? Welche Schmerzen standen mir noch bevor? Vor der Hand spürte ich nur immer stärker werdende Krämpfe im Leibe. Doch ich vermochte mich weder zu rühren noch einen Laut hervorzubringen. Wie ein Klotz lag ich auf dem Boden, inmitten der Stühle und Tische, ebenso leblos wie sie. Aber in meinem Gehirn jagten sich die Gedanken.
Endlich kommt mein Kammerdiener, der zum Umkleiden auf mich gewartet hatte und über mein Ausbleiben erstaunt war. Man bringt mich zu Bett und flößt mir sofort eine halbe Flasche Kognak ein, was die Schmerzen linderte und mir einen betäubten Schlaf verschaffte. Endlich erscheint der Staats-Doktor von Kapurthala. Er diagnosierte sehr vorsichtig, daß wohl manches auf eine Vergiftung hindeute, aber ebensowenig sei eine Nierenerkrankung ausgeschlossen, da mein Fall gewisse, dem Schwarzwasserfieber ähnliche Erscheinungen zeigte. Die Brechmittel, die er trotzdem verschrieb, blieben ohne Wirkung.
Doch ich kam mit dem Schrecken davon. Meine außerordentlich kräftige Natur, der Kognak und — die übergroße Vorsicht meiner Feinde retteten mir das Leben.
Wie sich später herausstellte, mußte man mich mit Dastura[6] vergiftet, aber die Dosis so stark gewählt haben, daß sie als Gegengift zu wirken begann. Zehn Tage lag ich zwischen Tod und Leben. Der Maharadscha erkundigte sich täglich sehr bewegt um mein Befinden. Doch die Rani Umedi ließ sich nicht blicken, noch auch etwas von sich hören.
Als ich besser war, war meine Geduld zu Ende. Ich zögerte[S. 89] nicht länger und gab Dschagatdschit Singh die Erklärung der Unglücksfälle und des Anschlages auf mich. Obgleich er jetzt ganz in der Hand der Gitana war, mußte er mir doch recht geben, daß ich unmöglich länger in seinen Diensten bleiben könne. Er bewilligte meine Entlassung und setzte mir eine Pension aus seiner Privatschatulle aus.
Ich aber beeilte mich, Indien zu verlassen, wo ich zwanzig Jahre meines Lebens in engster Berührung mit zwei der bedeutendsten Fürsten dieses Landes verbracht hatte: der eine arbeitsam, wissensdurstig, allem Geistigen zugetan, der andere gutmütig, schwach allem Sinnlichen erliegend — und keiner von beiden Sproß eines alten Fürstengeschlechts, sondern Kind des niederen Volkes, hervorgegangen aus den wimmelnden Millionen Indiens —, durch eine sonderbare Laune des Schicksals über ihresgleichen zu ungeheurem Reichtum und fast unbeschränkter Macht emporgehoben.

[S. 90]

Meine Stellung sowohl in Baroda als in Kapurthala als oberster Aufsichtsbeamter der fürstlichen Paläste brachte es mit sich, daß mir ebenfalls die Obhut der Marställe und Gestüte, sowie der für die vielen an den Höfen gehaltenen, zur Jagd abgerichteten Tiere oblag. Damit verbunden war es meine Aufgabe, die großen Jagdveranstaltungen der Fürsten vorzubereiten und zu leiten. Das gleiche galt für die Rennpferde, deren Ankauf oder Aufzucht und Pflege, sowie Training ich zu überwachen hatte.
Daher habe ich über die jagdlichen Verhältnisse wie auch über den leidenschaftlich betriebenen Rennsport in Indien ziemlich eingehende Kenntnisse sammeln können.
Das zahlreichste Wild in der Umgebung von Baroda stellen die Antilopen dar, die in großen Rudeln bis auf eine Wegstunde[S. 91] an die Stadt herankommen. Da die Eingeborenen keine Erlaubnis haben, andere Feuerwaffen, als ganz veraltete Vorderlader, zu benutzen, und die Mehrzahl der Landbevölkerung der Provinz Gutscherat, in der Baroda liegt, der Kaste der Gusurati angehören, denen ihre Vorschriften und ihr Glauben verbieten, irgendein lebendes Wesen, und sei es eine Schlange, zu töten, so sind die Antilopen gegenüber den auf den Feldern arbeitenden Bauern nur wenig mißtrauisch.
Immerhin pflegen sie sich beim Äsen in der Mitte eines ganz ebenen Feldes zu halten, wo weder Bäume noch Sträucher, noch sonst eine Deckung vorhanden ist, die ein unbemerktes Heranpürschen gestatten würde. Die Herde wird von einer alten Antilopen-Kuh bewacht, die bei dem geringsten Anzeichen, das ihre Furcht erregt, Laut gibt, worauf die Tiere mit ihrer außerordentlichen Schnelligkeit im Nu verschwunden sind. Die Böcke weiden stets etwas abseits von der eigentlichen Herde und sind an ihrem Gehörn, sowie an dem dunkelbraunen Rücken und der weißen Farbe des Bauchfelles leicht erkennbar. Der Erfolg einer Jagd auf Antilopen hängt daher ganz davon ab, daß man sich unbemerkt auf Schußnähe heranpürschen kann und daß man mit dem ersten Schuß sein Tier erlegt. Die anderen sind, noch ehe man ein zweites Ziel suchen könnte, längst außer Schußweite. Und ebenso ist ein verwundetes Tier, selbst wenn ihm nur noch drei Läufe zur Verfügung stehen, kaum noch einzuholen.
Trotz der Häufigkeit der Tiere ist daher die Jagd auf Antilopen in Indien nicht einfach. Um in Schußweite zu kommen, benutzt man ihre verhältnismäßige Sorglosigkeit gegenüber einer Annäherung der ihnen gewöhnten bäuerlichen Wagen, in deren Schutz man hoffen darf, sie zu überlisten. Man bedient sich hierbei entweder des landesüblichen Ochsenkarrens oder man benutzt zwei besonders hierzu abgerichtete Büffel, die, im Joch zusammengespannt, einen belaubten Busch zwischen sich tragen, hinter dem der Jäger und der Führer verborgen bleiben.
Diese gegen Weiße sehr scheuen Büffel müssen von einem ihnen[S. 92] vertrauten Eingeborenen gelenkt werden, denn die Leitung ihrer Bewegung auf die grasende Herde zu verlangt große Geschicklichkeit. Sobald man in Schußweite ist, gibt der Führer hinter dem Joch Raum, und man feuert durch das Laub, wobei die feuerfest dressierten „bullocks“, die Ochsen, unerschütterlich stehen bleiben.
Bei der Benutzung des zweirädrigen Ochsenkarrens, der „Tonga“, verbirgt der Jäger sich auf dem Sitz. Der Fahrer, stets ein Eingeborener, hockt auf der Deichselspitze und sucht möglichst ungesehen, nahe an die Herde heranzukommen. Ist es ihm gelungen, bis auf 200 oder 150 Meter heranzulavieren, so führt er die Tonga langsam in dieser Entfernung an der Herde entlang, und der Jäger läßt sich auf einen Wink des Fahrers vorsichtig und leise mit schußfertiger Büchse zur Erde gleiten, während der Wagen ruhig weiterfährt. Ihn behalten die Antilopen etwas im Auge, während es von der Ruhe und Sicherheit des Jägers abhängt, ob sie ihn bemerken und zum Schusse kommen lassen.
Die beste Büchse, die ich für diese Jagd ausprobiert habe, ist die englische Doppelflinte Expreß Point 450, Visier bis 400 Yards (360 Meter). Ein richtigsitzender Schuß aus ihr bringt das Wild unfehlbar zur Strecke, während kleinere Kaliber viel weniger zuverlässig sind.
Diese Pürschjagd wird von den Maharadscha aber nicht ausgeübt. Sie ziehen Treibjagden vor, zu denen ganze Regimenter von Eingeborenen zu Fuß und zu Pferde aufgeboten werden. Die fürstliche Jagdgesellschaft nimmt auf Elefanten Platz und knallt von dort aus das massenhaft aufgescheuchte Wild wahllos nieder, so daß die Jagd zu einer reinen Massenschlächterei wird. Der Gaekwar von Baroda war, seinem ganzen Charakter entsprechend, kein Freund dieser Art von Vergnügungen. Nur wenn die Tiere durch übergroße Vermehrung zur Landplage wurden und unübersehbaren Flurschaden anrichteten, duldete er das Abhalten dieser bluttriefenden Treibjagden.
Andere indische Fürsten haben früher das zusammengetriebene Wild mit Kartätschen zusammenschießen lassen, um das Schauspiel[S. 93] einer solchen Metzelei in besonders kondensierter Form zu genießen.
Eine andere, allerdings sehr kostspielige Art der Jagd auf Antilopen ist die mit „Tschittahs“. Sie kann nur von Fürsten oder reichen Semindaren — Großgrundbesitzern — betrieben werden und findet daher selten anders als zur Ehrung persönlicher Freunde oder hoher englischer Beamter statt.
Der „Tschittah“ ähnelt dem Leoparden, er erreicht die Höhe eines ausgewachsenen russischen Barsoj-Hundes, dem er auch im Bau ähnelt, und ist von fabelhafter Schnelligkeit. Fast immer stammt er aus den Dschungeln Zentral-Indiens oder der Provinz Khattiawar, wo er in Fallen gefangen wird. Seine Dressur wird von indischen Jägern — „Schikari“ — berufsmäßig betrieben und erfordert außerordentliche Geduld, wie sie eben nur ein Inder aufbringen kann. Der Tschittah muß so zahm wie ein Jagdhund werden, obgleich er zur Familie der Katzen gehört. Sein Erzieher hängt auch mit ganzer Liebe an ihm, läßt ihn in seinem Schlafraum schlafen und führt ihn wie einen Hund in der Stadt spazieren, um ihn an den Anblick von Menschen zu gewöhnen. Wenn er zur Jagd gebracht wird, trägt der Tschittah anstatt eines Maulkorbes eine schwarze Lederkappe über den Augen. Mir standen in Baroda ein gutes Dutzend dieser Tiere zur Verfügung.
Zur Jagd wird der Tschittah entweder auf einem hochachsigen, zweirädrigen Ochsenkarren, wo er auf einer dünnen Matratze sitzt, gefahren, oder ein berittener Schikari nimmt ihn auf das Pferd. Zu diesem Zwecke wird für ihn am Hinterzwiesel des Sattels ein kleines, indisches Bett angebracht. Bei der Eigenschaft der Antilopen, allem Eingeborenen, sei es nun Pferd oder Bauer oder Karren, nur geringe Beachtung zu schenken, unterscheidet sich das Anschleichen mit dem Tschittah in nichts von dem Anpürschen mit der Büchse. Die in einiger Entfernung folgenden berittenen Zuschauer schwenken vorsichtig auf die Herde ein, sobald der Schikari mit dem Tschittah auf etwa 200 Meter an die äsenden Tiere herangekommen ist. Sein Wärter nimmt[S. 94] ihm die Kappe von den Augen, kettet ihn los, und er schlüpft zur Erde. Unter Ausnützung jeder sich ihm bietenden Deckung schleicht der Tschittah, seiner Natur gemäß, katzengleich bis auf etwa 50 Meter an die Herde heran, wählt sich den stärksten Bock zum Opfer, erhebt sich und springt in einigen gewaltigen Sätzen auf das Beutetier los, so daß es wie gelähmt sekundenlang verwirrt stehen bleibt. Gelingt es dem Tschittah nicht, die angegriffene Antilope für diese kurze Zeit unbeweglich zu halten — was höchst selten vorkommt —, so ist der Bock gerettet. Die anderen sind sofort bei seinem Aufrichten davongejagt und längst über alle Berge. Niemals wird es dem Tschittah gelingen, eine Antilope einzuholen. Er wird auch nie einen Versuch dazu machen, da ihm seine Unterlegenheit im ausdauernden Streckenlauf scheinbar ganz bewußt ist.
Hat er aber den Bock erreicht, so schlägt er ihm mit der Tatze ins Kreuz, so daß das Tier zusammenbricht, und beißt sich sofort an der Kehle fest.
Ein gut dressierter Tschittah wird niemals sich an einer Hindin vergreifen, sondern stets sich einen Bock erwählen, wie es ja in Indien überhaupt für schimpflich gilt, eine Hindin zu schießen, obgleich ihr Fleisch schmackhafter als das der Antilopenböcke ist.
Um den Tschittah von seinem Opfer zu lösen, was stets eine etwas heikle Sache ist, schneidet der Schikari meistens die Schlagader des Bockes unterhalb der Bißstelle durch und fängt das Blut in dem mitgeführten Freßnapf seines Zöglings auf. Der Geruch des frischen Blutes veranlaßt dann den Tschittah, von seiner Beute abzulassen und sich dem Napf zuzuwenden. Er darf das Blut aber nur nehmen, wenn an demselben Tage nicht weiter gejagt wird. Sobald sein Schikari ihm die schwarze Kappe wieder über die Augen gelegt hat, wird er fügsam und folgt ihm willig zu seinem Sitz zurück.
Von den Schikari, die zum Bestande jedes Hofes, wie überhaupt jeder Jagd gehören, ist ein Teil Mohamedaner, ein Teil Hindu. Verschieden wie ihr Glaube ist auch ihre Betätigung.[S. 95] Der gemessene, ruhige, würdevolle Mohamedaner beschäftigt sich vornehmlich mit dem Abrichten der Tschittah, der Liux, des Falken und des Habichts für die Beize. Der Liux, etwas kleiner als der Tschittah, wird selten gefangen, und es kostet unsägliche Mühe, diese starke Katze ihrer Raubtierinstinkte zu entwöhnen. In Baroda waren zwei vorhanden, ohne daß ich sie je zur Jagd hätte verwenden können.
Die Hindu-Schikari, die meistens der Kaste der Bauri angehören, beschäftigen sich vornehmlich mit dem Abrichten der Jagdhunde, wozu der Nepaul- und der Thibethund, auch der wilde Pariahund gebraucht wird. Sie dienen vornehmlich zum Aufstöbern des Wildes, besonders des Wildschweines. Der Versuch, europäische Jagdhunde nach Indien einzuführen, ist stets gescheitert. So schonend sie auch behandelt werden, das Klima zerstört unweigerlich ihren Geruchssinn und ihre Gesundheit. Ich habe als leidenschaftlicher Hundefreund mir die größte Mühe gegeben, europäische Hunde in Indien zu akklimatisieren. Im Sommer sandte ich sie hoch ins Gebirge, in die kühle Bergfrische Mussoorie, um sie vor der glühenden Hitze der Ebene zu bewahren. Am widerstandsfähigsten erwies sich noch der Fox-Terrier und der Bull-Terrier. Letzterer ist vorzuziehen, weil er sich nicht mit jedem Pariahunde herumbeißt, wie dies die Fox-Terrier tun. Da diese Pariahunde fast durchgängig verseucht sind, bringt die kleinste Bißverletzung dem Angreifer die Tollwut. Der Bull-Terrier ist ein stets kampfbereiter Kumpan und, dank seiner Abstammung von der Bulldogge, kräftiger als der Fox-Terrier, aber viel gewandter als die Dogge. Daher behält er im Kampfe leichter die Oberhand, und der Pariahund ist schon erledigt, bevor er überhaupt zum Biß kommen kann. Auch einen deutschen Schnauzerl und zwei belgische Schäferhunde habe ich nach Indien gebracht. Sie lebten fünf Jahre und verendeten dann an Krankheiten, die kein Tierarzt festzustellen vermochte.
[S. 96]
Nur Fürsten und die Offizierkorps englischer Kavallerie-Regimenter können sich den Luxus erlauben, in den Ebenen den Schakal, so wie den Fuchs in England, mit einer großen Meute zu jagen. Infolge des starken Abganges in den Meuten ist ein sehr bedeutender Nachschub aus England notwendig. Hunde, die in diesen Meuten in Indien geworfen werden, degenerieren sehr schnell. Kreuzungen zwischen englischen Fuchshunden und indischen Rampurhunden ergeben zähe, angriffslustige Parforce-Jagdhunde, doch ohne besonders gute Witterung. Die Kreuzung ist äußerst wild und bissig. Sogar die Pariahunde nehmen Reißaus, wenn eine Meute solcher Hunde durch das Dorf rast.
Die einheimischen indischen Pariahunde sind zu tausenden auf den Straßen greifbar. Sie sind für jeden Bissen dankbar und folgen jedem freundlichen Blick. Allerdings sind sie zu nicht viel mehr als dem Aufstöbern des Wildes benutzbar, und wenn sie nicht scharf überwacht werden, fressen sie die halbe Beute auf, ehe man noch hinzukommen kann, ganz gleich ob es sich um eine Wachtel oder einen Büffel handelt.
Bei der Jagd auf Wildschweine, zu der diese Hunde vorzugsweise gebraucht werden, ist schon mancher von ihnen den Hauern des Ebers erlegen. Andererseits habe ich selbst beobachtet, wie drei von ihnen einen Eber durchaus weidgerecht niederhielten, bis er den Fangstoß erhielt.
Doch die besten Spürhunde in Indien sind unstreitig die Hindu-Schikari. Sie haben ein wunderbares Auge für jede Gattung Wild, sind untrüglich auf jede Entfernung und besitzen eine Art Witterung für die Tiere. Ihnen gegenüber hilft keine Schutzfarbe, und sie übertreffen den besten Feldstecher. Dazu besitzen sie eine staunenswerte Ausdauer und sind, im Vergleich zu uns, einfach unermüdlich.
Trotz allen Erzählungen von und über Tigerjagden in den Dschungeln Indiens ist aber die gefährlichste und aufregendste Jagd unstreitig „Pigsticking“, auf Deutsch: Schweinestechen. Die[S. 97] Schweine jedoch, um die es sich hier handelt, sind die wilden Warzenschweine, und die Jagd findet zu Pferde mit der Lanze als einziger Waffe statt. Es ist die alt-germanische Jagd auf den „mächtigen Eber“ — den starken, blitzschnellen, gewandten und tapferen Keiler.


Nichts Herrlicheres kann es geben, als an einem frischen, indischen Morgen auf einem Vollbluthengst, der selbst die Jagd liebt, die Lanze in der Faust, zur Jagd auf den wilden Eber aufzubrechen. Der Ritt hinter dem Keiler, der hartnäckige Kampf mit dem wendigen, gelenken Tiere ist mit irgendeiner Parforce-Jagd überhaupt nicht zu vergleichen. Dort fehlt alle Spannung, jede Gefahr, und der Wettstreit zwischen den Reitern, als Erster zum Lanzenstoß auf den wehrhaften Eber zu kommen.
Doch es ist eine Jagd, die nur wenigen in Indien möglich ist. Nur auf Einladung eines Fürsten oder des Offizierskorps eines der vornehmsten Kavallerieregimenter oder aber als Mitglied des Zelt-Klubs — des „tent-club“ — kann man Gelegenheit dazu erhalten. Und Mitglied des Zeltklubs zu werden, ist außerordentlich schwer, ganz abgesehen, daß man den Besitz von wenigstens drei guten, ausdauernden Pferden nachweisen muß.
Denn als erstes und wichtigstes für die Jagd kommt das Pferd in Frage. Es muß so fußsicher sein, wie nur möglich. Das Gelände ist überall stark zerklüftet, uneben, mit Fallen und Löchern besät, besonders wenn die Jagd durch Gestrüpp geht. Das gefährlichste sind die Elefantenspuren, von den schweren Tritten dieser Tiere verursachte, im dichten Gras ganz unsichtbare Löcher, die bis zu zwei Fuß Tiefe haben und die die Elefanten im Dschungel hinterlassen, wenn sie während der Regenzeit zum Grasholen ausgeschickt werden.
Die beste Zeit zur Eberjagd ist die Zeit nach der Ernte, die schon in den Anfang der heißen Jahreszeit fällt. Daher muß man ganz früh aufbrechen, denn nach neun Uhr beginnt die Hitze Mensch und Tier zu erschlaffen. Der Gaekwar von Baroda hielt die Hofjagden von Ende Dezember bis Anfang Februar ab.[S. 98] Während dieser sogenannten kalten Jahreszeit ist es schwieriger, den Eber auf das offene Feld zu bringen, da er sich dann mit Vorliebe in den Dschungeln oder den hohen Baumwoll-, Zuckerrohr- und Getreidefeldern aufhält, aus denen er sich ungern vertreiben läßt. Die Grasdschungel sind große, mit mehr denn zwei Meter hohem, dicht verschlungenen, zu Fuß und zu Pferde beinahe undurchdringlichem Gras bestandene Strecken. Zum Treiben hier eignet sich der Elefant am besten.
In Baroda befanden sich die Eberjagdgründe in der Nähe von Dabkar, unweit der Mündung des Mahiflusses in den Golf von Cambay. Das Gelände dort war mit fast manneshohen, dornigen Büschen besetzt, deren dicke Wurzeln in verschlungenem Gewirr den Boden bedeckten. Man muß ihnen sorgfältig aus dem Wege gehen, und selbst der Eber meidet sie, bieten sie doch auch für ihn natürliche Fallen. Dazwischen stehen vereinzelte Kaktushecken, die die Bauern zum Schutze ihrer Felder vor Wildschaden um die Anpflanzungen ziehen. Sie sind oft bis zwei Meter hoch, und man muß sich hüten, sie als Abschluß eines Jagdgalopps zu wählen. Auch ist verschiedentlich Wasser im Gelände: Bäche, Kanalrinnen, Tümpel und Sumpflöcher. Alle diese Hindernisse tauchen ganz plötzlich auf der Eberjagd auf, und nicht so sehr Vorsicht, als schnellste Entschlossenheit sind erforderlich, sie zu überwinden oder zu umgehen, denn der Eber selbst ist nicht wählerisch in seinem Wege. Einmal aus seiner Ruhe im Dickicht aufgejagt, versucht er zunächst durch dick und dünn nach dem mit Gestrüpp bewachsenen Teile des Jagdgrundes durchzubrechen. Gelingt ihm dies nicht, so schlägt er einen Haken, um, wenn möglich, in dem nächsten Zuckerrohr- oder Baumwollfeld zu verschwinden.
Von den Teilnehmern einer Eberjagd, vielleicht zwölf, wird der erfahrenste zum Jagdmeister — master of the Hunt — gewählt. Seinen Anordnungen ist unbedingt Folge zu leisten. Er teilt die Gesellschaft in Gruppen von je drei Mann, von denen wieder einer zum Führer der anderen beiden bestimmt wird.
[S. 99]
Wer mit der Lanze nicht umzugehen versteht, ist für die Jagdteilnehmer wie auch für sein Pferd eine ernste Gefahr. Die Lanze besteht aus einem sehr festen (männlichen) Bambusschaft, auf dem eine haarscharfe Stahlspitze aufgesetzt ist, die in eine dünne Nadel ausläuft. Die Länge hängt von der Größe des gerittenen Pferdes ab. Zum Angehen des Ebers eignet sich am besten eine sieben bis acht Fuß lange Lanze, besonders wenn der Eber angreift, während die kurze Lanze, die oberhalb der Stahlspitze mit Blei beschwert ist, mehr dem wohlgezielten Todesstoße dient. Verliert der Reiter die Lanze, oder zerbricht sie im Kampfe, so bleibt ihm nur übrig, sich von den Treibern eine neue zu holen, denn andere Waffen sind nach den Jagdregeln nicht zulässig.
Es erfordert große Ruhe und Geschicklichkeit, in der ganzen Aufregung der bewegten Jagd richtig mit dieser Eberlanze umzugehen. Einmal habe ich erlebt, wie ein Neuling die Lanze zu Boden gesenkt hielt, ehe er überhaupt an den Keiler heran war. Mitten im Galopp prallte er damit gegen einen harten Gegenstand. Der Schaft brach und das Vorderende schoß aufwärts in den Hinterschenkel des Pferdes, den es bis zum Schweif durchbohrte. Glücklicherweise wurde kein Knochen verletzt, so daß das Tier nach einigen Wochen wieder gesund war.
Sind nun die verschiedenen Gruppen von dem Jagdmeister zusammengestellt, so erhalten sie ihre Plätze in Abständen von etwa einem Kilometer hinter hohen Baumbeständen und Gebüsch angewiesen. In ihrem Rücken liegt die Linie der Treiber, die durch die Dschungeln näherkommen, sobald der Jagdmeister das Zeichen zum Beginn gibt.
In Baroda wurde das Treiben meistens von einem Dutzend Elefanten unterstützt, deren Führer auf Trommeln den notwendigen Lärm machten. Zwischen den Elefanten ritten Sowars des Gaekwar und Schikari. Zahllose freiwillige Fußtreiber aus den Bewohnern der Gegend vervollständigten die Treiberkette. Wenn die Jagd gut ist, sind die Jäger gern zu einem Geschenk bereit, und zehn bis zwanzig Rupien — etwa 15 bis 30 Mark — waren[S. 100] damals schon ein fürstliches Geschenk in dieser bettelarmen Gegend. Und dies nicht etwa für einen Mann, sondern für ein ganzes Dorf. Es wird dem „Patel“, dem Dorfältesten, übergeben, der es dann verteilt. Unsere „Kitmagar“ — Diener — verkauften den Leuten billig die hochgeschätzten leeren Sektflaschen, und in allen Fällen wird ihnen das Fleisch mehrerer erlegter Eber zugestanden. Dann ist der „Riot“ — der Ackersmann —, auf dem fast ausschließlich die ganze Steuerlast Indiens liegt, froh in seiner Armut und hat auch für den Sahib, den Herrn, nur gute Worte.
Sobald nun die lange Reihe der Treiber mit ohrenbetäubendem Lärm sich in Bewegung gesetzt hat, wird es überall im Dschungel lebendig. Zunächst kommt alles mögliche Getier zum Vorschein und flüchtet über die offene Strecke ins nächste Gebüsch. Zuletzt erscheint der Eber mit seiner Familie. Die Bachen mit den Frischlingen in Rudeln zu dreißig Stück und mehr machen die Spitze. Dann erst folgt der „gewaltige Eber“, manchmal auch eine vereinzelte Sau.
Nach den Jagdregeln darf eine Sau oder Bache nicht angegriffen werden. Doch auf große Entfernung ist es oft schwer, eine einzelne Sau von einem Eber zu unterscheiden. Es ist daher üblich, daß der an der Spitze jeder Gruppe reitende Führer die Lanze senkt, sobald er einen solchen Irrtum bemerkt. Die Gruppe bricht dann die aufgenommene Verfolgung ab und kehrt zu ihrem Standplatz zurück, um das Ausbrechen eines Keilers abzuwarten.
Sind die Treiber näher an den Rand des Dschungels gelangt, so steigt die Erwartung auf das äußerste. Ein Eber taucht auf. Erst hält er Umschau, und glaubt er die Luft rein, trottet er gemächlich über das freie Feld. Die Reiter, die er in ihrem Versteck nicht bemerkt hat, lassen ihm einen Vorsprung von 400 bis 500 Meter, ehe sie die Verfolgung aufnehmen.
Zunächst muß die Taktik des Ebers festgestellt werden, um ihn an einem Durchbruch nach rückwärts zu verhindern. Die Gruppe[S. 101] der Jäger teilt sich daher, und ein jeder galoppiert, ohne den Eber aus dem Auge zu lassen, seinen eigenen Weg. Jeder von ihnen hat den Ehrgeiz, den Eber zuerst anzunehmen. Der Keiler selbst galoppiert jetzt mit höchster Kraft. Es ist schwer, einen Begriff von der Behendigkeit und Schnelligkeit eines indischen Ebers zu geben. Beides kommt einem erst zu Bewußtsein, wenn man selbst zu Pferde in gestrecktem Galopp ihn an Geschwindigkeit zu übertreffen sucht.
Doch der vorderste und schnellste Reiter hat den Sieg noch nicht in der Tasche. Wird er dem Eber zu gefährlich, so beginnt der Keiler ein verzweifeltes Zickzackspiel, um der Lanze auszuweichen, wechselt plötzlich die Richtung, und bevor das mit dem Aufgebot aller Kraft galoppierende Pferd noch herumgeworfen werden kann, hat schon der rückwärts folgende Reiter Gelegenheit, einen ersten Stich abzugeben. Und nun packt den Keiler die Wut. Er wirft alle Hoffnung auf Sicherheit von sich und ist nur noch der Kampfeber, der sein Leben bis zum letzten Atemzug mit mächtigem Grimme verteidigt und nicht müde wird, immer und immer wieder anzugreifen, bis er den Todesstoß erhält. Dann sinkt er ohne einen Laut zusammen.
Aber nicht jeder Eber ergreift die Flucht, wenn er den Galopp des Verfolgers hört. Es gibt unter ihnen alte, gewitzigte Herren, die schon manchen Kampf bestanden und manche Erfahrungen hinter sich haben. Diese eisgrauen Helden — nach den Jagdregeln darf nie ein Eber unter zwei Fuß Höhe angenommen werden — verstehen, worauf es ankommt. Sie zeigen wenig Lust zum Galoppieren. Sie kennen die Überlegenheit der flinken Pferde. Daher machen sie halt, sobald sie die Angreifer merken, drehen um und gehen selbst sofort zum Angriff über. Mit voller Wucht wirft sich ein solcher Eber dem Reiter entgegen und sucht ihn zu überraschen, in der Hoffnung, das sichere Dschungelversteck wieder erreichen zu können, aus dem ihn dann kein noch so lauter Lärm der Treiber von neuem vertreiben wird.
Sein Angriff muß daher ohne Zögern aufgenommen werden. Er[S. 102] versteht keinen Spaß, erspäht sofort jedes Schwanken, jede Unentschlossenheit des Neulings und weiß blitzschnell, wohin er sich zu werfen hat, um dem Pferd den Leib aufzuschlitzen oder die Fesseln zu zerschneiden. Wehe dem, der zu Falle kommt. Er ist ihm unrettbar verfallen.
Sollte der erste Stich fehlgegangen sein, so muß der Eber ständig umkreist werden, bis man Gelegenheit zu einem neuen Stoß erhält. Dabei ist die Lanze nicht steif in der Hüfte, wie etwa bei der — vergangenen — deutschen Kavallerie, zu halten. Sie wird mit lockerer Schulter und gerecktem Arm geschwungen und mehr wie ein Speer im Abwärtsstoßen gebraucht. Bei der Schnelligkeit, mit der sich ein solcher Zweikampf zwischen Reiter und Keiler abspielt, ist zu einem Zielen nach dem geeigneten Körperteil keine Zeit. Nur Stiche gegen den Kopf müssen vermieden werden, da die Lanze dort abprallen und zersplittern könnte.
So kommt es vor, daß bei dem ersten Angriff die Lanze der Länge nach in die Weichteile des Tieres hineingestoßen wird, dabei im Vorbeigaloppieren der Hand des Reiters entschlüpft und nun zwischen Haut und Fell des Ebers stecken bleibt. Oder der Stoß gelang. Die Lanze steckt fest im Körper des Tieres, das, an dem Reiter vorbei, in entgegengesetzter Richtung davonstürmt. Dabei läßt der Jäger die Lanze nicht aus der Faust. Sie bricht ab, und der Lanzenkopf bleibt in dem verwundeten Keiler stecken.
Die fliehenden Eber sind meist noch nicht ausgewachsene, aber doch über zwei Fuß hohe, muskulöse, sehnige Tiere. Sie galoppieren durch dick und dünn, überspringen schlank meterhohe Kaktushecken, kreuzen Bäche und Kanäle, und, in die Enge getrieben, durchschwimmen sie sogar Flüsse. Doch schnelles Schwimmen ist nur der letzte Ausweg. Sie sind im Wasser zu hastig, greifen mit den Hinterläufen zu weit nach vorn, wobei es geschehen kann, daß sie mit den scharfen Rändern ihrer Hufe sich selbst den Hals auf beiden Seiten aufschlitzen. Sind sie aber[S. 103] einmal durch einen Stich verwundet, dann sucht auch der junge Eber keinen Ausweg zur Flucht mehr, sondern stellt sich zum Kampfe wie ein alter.
So ist der wilde Eber sicherlich der tapferste, zäheste und todesmutigste Gegner, den der beste Reiter sich wünschen kann. Der Kampf mit ihm stellt aber nicht nur die höchsten Anforderungen an den Reiter selbst, sondern ebenso an sein Tier.
Das Pferd ist bei der Eberjagd der wichtigste Faktor. Das beste Tier, das ich jemals zu diesem Zwecke besaß, war ein Halbblut, ein australischer Wallach, 15 Hand (1,50 Meter) hoch, ein Abkömmling des sogenannten „Stockhorse“, die von den australischen Viehhirten zum Treiben und Einfangen der großen Herden benutzt werden. Dies erfordert ein hartes, unverwüstliches Tier, legt doch ein solcher Australier — wie der Hengst „at last“ — bis zu 150 Kilometer am Tage ohne übermäßige Ermüdung zurück. Sie sind jedoch kaum zu kaufen, da ihre Besitzer sie meist selbst viel zu nötig brauchen. Am ehesten kann man sie noch als Zugabe bei einem größeren Pferdekauf erhalten, wie es mir bei meinen öfteren Remonteeinkäufen für die Staatsstallungen glückte.
Das nächstbeste Pferd für diese Jagd ist das englische Vollblut oder ein edles Araber-Blutpferd, da die ersteren sehr teuer sind. Die besten und rassereinsten arabischen Pferde stammen aus dem „Nedsch“ genannten Binnenhochlande der arabischen Halbinsel. Sie werden „Nefadi“ oder „Nedschi“ genannt. Zwar ist die Ausfuhr der wirklichen, hochgezüchteten Araberpferde bei Todesstrafe verboten, und solche kommen auch nur als Geschenk an mohamedanische Fürsten außer Landes. Aber schon unter den gewöhnlichen arabischen Wüstenpferden finden sich ganz prachtvolle Tiere.
Der arabische Vollbluthengst benimmt sich sehr ruhig und zurückhaltend. Einige meiner besten arabischen Deckhengste waren[S. 104] vorzügliche Eberjagdpferde. Wenn sie in Bewegung waren, machten andere Pferde, auch Stuten, keinen Eindruck auf sie. Mit Herz und Huf bei der Sache, waren sie voller Aufregung, losgaloppieren zu können.
Ganz erstaunlich ist die Fußsicherheit des arabischen Pferdes. Selbst im schärfsten Galopp über schwieriges, mit natürlichen Hindernissen bestreutes Gelände ist es wendig und von katzengleicher Sicherheit. Höchstens durch gänzlich versteckte Fallen, wie die von den schweren Fußtritten der Elefanten verursachten, im dichten Grase ganz unsichtbaren Löcher, oder plötzlich auftauchender, unerkannter Sumpfsand können es zum Stürzen bringen. Auf ebener Straße dagegen läßt seine Aufmerksamkeit nach, und es neigt zum Stolpern und stürzt gegebenen Falles. Daher ist es gut, ihm sogleich nach dem Aufsitzen Gelegenheit zu einem harten Galopp zu geben, was es ermuntert und anregt.
Im Stalle ist das arabische Pferd die Sanftmut selbst. Auch zum Scheuen sind sie meistens zu klug. Wenn sie etwas noch nie Gesehenes bemerken, etwa einen Elefanten oder einen Kraftwagen, so treibt sie eher die Neugierde, näher heranzukommen und das Ungewohnte zu besehen, als in wildem Seitensprung auszubrechen.
Es ist bekannt, wie sehr der Araber sein Pferd liebt, das er mehr pflegt als sich selbst. Was mir aber stets besondere Hochachtung abnötigte, war die Beobachtung, daß sie das so empfindliche Maul des Tieres schonend behandeln. Unter meinen arabischen Pferden befand sich keins, das nicht bequem auf Trense zu reiten war.
Die Inder dagegen gebrauchen grausame Gebisse, schon weil sie so ungeschickte Hände haben. Selbst das beste Pferd, das man einem Inder auch nur für kurze Zeit anvertraut, kann durch dessen rohe Zügelhandhabung vollständig verdorben werden. Damit soll nicht gesagt sein, daß der indische Sowar — Reiter — nicht vorzüglich zu reiten verstehe. Zum Einbrechen der wilden, bockigen Australier ist er gut geeignet, schon weil er, mit stoischer[S. 105] Ruhe begabt, außerordentliche Geduld besitzt und wie mit dem Pferde verwachsen im Sattel sitzt.
Die indischen Pferde — country bred — sind selten gute Eberjagdpferde, außer sie sind von besonderer Zucht, etwa aus einer Kathiawari-Stute von einem englischen, arabischen oder australischen Hengst. Im allgemeinen aber sind diese Mischlinge zu nervös und brechen im entscheidenden Augenblick vor dem anstürmenden Keiler aus.
Unter meinen eigenen Pferden befand sich ein arabischer Goldfuchs, „Foxy“, der in jeder Hinsicht vollkommen war. Er gelangte durch Zufall in meinen Besitz. Als ich zum Einkauf von Poloponies — Polo ist ein in Indien sehr beliebtes Rasenball-Spiel für Reiter, in seinen Regeln dem „Hockey“ verwandt — in Bombay war, machte mich ein mir bekannter englischer Tierarzt auf ein Tier aufmerksam, das, mit einer arabischen Pferdesendung zu Schiff eingetroffen, beim Verladen unglücklich gestürzt war und sich große Abschürfungen an den Knien zugezogen hatte. Ich erwarb Foxy für die Summe von 350 Rupien, etwa 550 Goldmark. Seine Verletzungen heilten bald, und ich ließ ihn vom offiziellen Messer des Poloklubs messen.
In Indien muß jedes Pony, das in die Polo- oder Rennregister eingetragen werden soll, von dem Beamten des indischen „Turf-Club“ gemessen werden. Ist es nur zwei Jahre alt, so muß die Messung bis zu seinem fünften Jahre jährlich wiederholt werden. Dann gilt es als ausgewachsen. Alles kommt darauf an, daß das Tier nicht höher als 14½ Hand (145 cm) ist. Größere Pferde dürfen nicht mehr an den Rennen und Polowettspielen teilnehmen. Das Maß bestimmt auch die Gewichtsbelastung. Allerhand zum Teil direkt tierquälerische Praktiken werden angewandt, die Pferde so klein wie möglich erscheinen zu lassen. Die Hufe werden bis zur äußersten Grenze beschnitten, so daß das Tier nur unter großen Schmerzen stehen kann. Oder man legt ihnen vor der[S. 106] Messung tagelang schwere Säcke auf oder hindert sie am Schlafen, damit sie, dem Messer vorgeführt, mit eingebogenen Knien stehen und dadurch kleiner erscheinen. Der offizielle Messer ist ebenso unbestechlich wie scharfäugig und kann zur Vergewisserung über die Rennfähigkeit des Ponies einen Probegalopp verlangen. Allzu extreme Täuschungsmittel können also nicht in Anwendung kommen.
Nun maß mein „Foxy“ nur 13½ Hand. Hätte er eine Hand mehr gemessen, wäre seine Belastung im Rennen um 42 (englische) Pfund höher gewesen, was sehr viel ausmacht. Außerdem war Foxy schon fünf Jahre alt, brauchte also dem Messer nicht nochmals vorgeführt zu werden.
Damals, Ende der neunziger Jahre des vorigen Jahrhunderts, war einer der großzügigsten und reichsten Rennstallbesitzer Indiens der Maharadscha von Patiala. Selbst einer der besten Herrenreiter und Polospieler, war ihm für ein gutes Pferd kein Preis zu hoch. Er war gleichzeitig mit dem Maharadscha von Kapurthala, in dessen Begleitung ich mich befand, 1899 zu den Rennen nach Simla gekommen, wo ich „Foxy“ für alle Hauptrennen hatte nennen lassen, und in denen auch die Pferde des Maharadscha von Patiala liefen. Jedoch „Foxy“ ging stets als erster durchs Ziel, sehr zum Verdruß des Maharadscha von Patiala und sehr zur Freude des von Kapurthala. In Simla gibt es außer Geldpreisen auch noch wertvolle, vom Vizekönig, irgendeinem Gouverneur, dem Höchstkommandierenden oder einem indischen Fürsten gestiftete Pokale.
Der Maharadscha von Patiala legte nun alles darauf an, weiteren Siegen „Foxys“ über die Pferde seines eigenen Rennstalles vorzubeugen und sandte mir seinen Trainer, Scott, einen Australier, um mit mir über den Verkauf „Foxys“ zu verhandeln. Da es mir nicht erlaubt war, zu meinem eigenen Ruhme Pferde und Ponies laufen zu lassen, machte ich mir diese Gelegenheit zunutze und verlangte 20000 Rupien (über 30000 Mark) für das Pferd, welche Summe mir anstandslos bewilligt wurde,[S. 107] denn zwischen den indischen Fürsten herrscht eine unglaubliche Eifersucht auch in den kleinlichsten Dingen. Dem Maharadscha von Patiala war es, ganz abgesehen von seinem eigenen Rennstall, ein unerträglicher Gedanke, daß ein Beamter des Maharadscha von Kapurthala ein Pferd besitze, dem er nichts Gleichwertiges an die Seite stellen konnte. „Foxy“ lief ein einziges Rennen für den neuen Stall — um zum erstenmal geschlagen zu werden.
In der folgenden kalten Jahreszeit wurde ich vom Maharadscha von Patiala zur Eberjagd eingeladen. Eigene Pferde brauchte ich nicht mitzubringen. Da ich aus einem anderen Fürstenstaat kam, stand mir die Auswahl unter den hunderten des Maharadscha frei. Ich erbat mir nun kein anderes Pferd als eben „Foxy“, und wir feierten ein frohes Wiedersehen.
Die Eberjagd, zu der der Maharadscha einen schönen Pokal gestiftet hatte, sollte nach den Regeln des „Tent-Club“ abgehalten werden. 64 Jäger, die Höchstzahl, die teilnehmen darf, werden zu 32 Gruppen zusammengegeben. Ein jedes Gruppenpaar jagt einen Eber. Wer zuerst Schweiß an der Lanze ausweisen kann — mehr braucht der erste Stich nicht zu ergeben —, bleibt in der Jagd, der andere scheidet aus. Der Jagdmeister bestimmt, welches der zusammengelosten Paare den ausbrechenden Eber verfolgt. Ein Schiedsrichter begleitet jede Gruppe. Auch die Art und Weise des Stiches wird durch bestimmte Punktzahlen bewertet. Mit dem ersten Gang scheiden so 32 Bewerber aus; aus dem Rest werden neue Gruppenpaare gebildet und so fort, bis das letzte Paar um den Pokal kämpft.
Der Zufall nun wollte es, daß dieses letzte Paar aus dem Maharadscha selbst und mir bestand. Selbstverständlich ließ ich ihn siegen und damit seinen eigenen Pokal gewinnen, denn wie hätte ich mir erlauben dürfen, über einen Maharadscha zu triumphieren, noch dazu auf seinem eigenen Pferde!
Er mochte wohl meine absichtliche Ungeschicklichkeit bemerkt haben, denn als wir zusammen ins Lager zurückritten, machte[S. 108] er eine Andeutung über meinen Fehlstich, der ihn bei einem so erfahrenen Jäger wie mir erstaune. Zu genau mit den indischen Sitten vertraut, wehrte ich bescheiden ab und rühmte dagegen seine eigene Reitkunst, die ohne allen Zweifel sehr beträchtlich war, und sein Können als Eberjäger.
Da nun der Pokal von ihm selbst gestiftet war, blieb nichts anderes übrig, als ihn mir, dem zweiten Sieger, zuzuerkennen. Ich hielt einen entsprechenden Dankspruch und schloß mit dem Hinweis auf das gute Pferd, das er mir zu reiten erlaubt habe. Der Maharadscha, der das Tier natürlich nicht mit Namen kannte, erwiderte auf indische Art mit großer Geste: „Dumara ke bas hai“ — es ist dein!
So kam „Foxy“ wieder nach Kapurthala. Dem Trainer Scott hatte ich versprochen, das Pferd keine Rennen mehr laufen zu lassen. Im folgenden Jahre kam „Foxy“ dann als Deckhengst nach Australien und damit zur wohlverdienten Ruhe.
Foxy übertraf sogar das berühmte Pony „Mite“ (spr. Mait = Kleinchen), das derselbe Maharadscha von Patiala von dem früheren Militärsekretär des Vizekönigs, Lord William Beresford, für 25000 Rupien gekauft hatte. Der Lord war ein in allen Sätteln gerechter Sportsmann, der auch über die gerade beim Pferdehandel so notwendige Gerissenheit verfügte. „Mite“ mag die vom Maharadscha für ihn gezahlten 25000 Rupien wohl wert gewesen sein, doch Lord William Beresford war billiger zu ihm gekommen.
Ein Parsi-Sportsmann in Poona besaß einen kleinen Rennstall, in den sich einmal ein außergewöhnlich schnelles Pony unbekannter Herkunft verirrte, das Sieg auf Sieg gewann. Daher meldete es der Parsi als „Mite“ für das bedeutendste und meistgewettete Ponyrennen Indiens, für den „Civil Service Cup“, das in Lucknow gelaufen wird. Für das gleiche Rennen hatte Lord William Beresford ein Pferd, „Malice“ genannt, eintragen lassen, das mit viel Geld und Wetten gegen ihn bei den Buchmachern stand. Sollte nun „Mite“ das Rennen machen,[S. 109] so wäre dies der Ausfall einer recht bedeutenden Summe für den edlen Lord gewesen.
Als vorsichtiger Mann bot er daher dem Parsi noch vor dem Rennen an, ihm „Mite“ abzukaufen und zwar für 5000 Rupien, und falls „Mite“ gewönne, ihm die Hälfte des Preises, der 10000 Rupien betrug, zu überlassen. Hochgeehrt über das Anerbieten einer so bekannten Persönlichkeit, wie Lord William Beresford es damals war, nahm der Parsi an. Nun ging aber „Malice“ als erster durchs Ziel, und der Parsi war „Mite“ für nur 5000 Rupien losgeworden. Später gewann er noch zwei Rennen für seinen neuen Herrn, war dann aber zu berühmt geworden, als daß durch Wetten auf ihn noch Geld zu verdienen gewesen wäre. Als Wunderpferd jedoch war er gerade recht, um im Stalle des Maharadscha von Patiala zu glänzen.
Haben Pferderennen in Europa nur noch einen recht losen Zusammenhang mit dem angegebenen Ziele einer Verbesserung der Pferdezucht und dienen sie vornehmlich der Spielsucht und der Wettleidenschaft einer Menge, deren Pferdekenntnis erschöpft ist, wenn sie einen Rappen von einem Schimmel unterscheiden kann, so ist dies in noch viel größerem Ausmaße in Indien der Fall. Dort sind die Rennen nur und einzig eine Gelegenheit, Geld zu verdienen — oder zu verlieren. Das Gewinnen besorgen dort, wie anderswo, die „des inneren Ringes“, während das Verlieren zu den Vorrechten der Außenstehenden gehört.
So hatte derselbe Lord William Beresford, der „Mite“ auf so billige Weise zu erwerben gewußt hatte, ein gutes Vollblutpony, „Mulberry“, nach Indien gebracht. Es war nicht höher als 13 Hand, entwickelte aber im Galopp eine Schnelligkeit, die nicht zu schlagen war.
Vielbegehrt wanderte es von Stall zu Stall, bis es endlich in die Hände eines Syndikats geriet, das die Pferde stets unter Pseudonymen laufen ließ, so daß man der Ansicht war, es bestände wahrscheinlich aus Buchmachern.
Seitdem nun Mulberry aus Lord William Beresfords Händen[S. 110] war, fiel es stark ab. Ganz gewöhnliche Außenseiter liefen an ihm vorbei, so daß die Rennbehörde alle Rennen, in denen es auftrat, insgeheim scharf überwachen ließ. Bei einem Rennen in Lucknow nun gelang es, festzustellen, daß der australische Jockey, der das Pferd ritt, es stark verhalten hatte, um es durch zu kurze Zügel absichtlich um den Sieg zu bringen. Die Untersuchung ergab den üblichen Tatbestand. Mulberry war im Publikum heftig gewettet worden. Also sollte er nicht gewinnen. Daher wurde, ebenfalls wie üblich, „Mulberry“ disqualifiziert. Der Trainer wurde vorgeladen, doch der Name des Besitzers war nicht zu ermitteln. Das Pferd selbst erhielt vorläufig im Stalle eines pensionierten englischen Obersten in Amballa Unterkunft.
Von dort aus wurde „Mulberry“ zum Verkauf angeboten. Auch ich trat mit dem Oberst in Verbindung, da ich es im Dog-cart gehen lassen wollte. Rennen waren ihm verschlossen und als Wallach kam es für die Zucht nicht in Frage. Ich nahm an, das Tier um wenig Geld erstehen zu können. Während die Verhandlungen noch schwebten, finde ich eines Tages zu meiner Verwunderung in der Kalkuttaer Sportzeitung meinen Namen als Käufer „Mulberrys“ mit einer langen Erklärung, weshalb, wozu und warum ich das Pferd erwerben wolle.
Kurz darauf war ich mit dem Oberst über den Preis handelseinig geworden und wollte einen Stallburschen nach Amballa — nicht so sehr weit von Kapurthala — senden, um „Mulberry“ holen zu lassen, als mir gedrahtet wurde, das Pferd sei einem Schlangenbiß erlegen — ein trauriges Ende für das schnellste Pferd Indiens.
Etwa zwei Monate später war ich in Ägypten und besuchte das Rennen in Alexandrien. Der Sieger im Hauptrennen dort erinnerte mich stark an das so rasch verstorbene Vollblut „Mulberry“, und ich sah mir das Tier etwas genauer an. Ich war sicher, es mit dem toten „Mulberry“ oder aber mit seinem Geist zu tun zu haben.
Als ich nach Indien zurückkam, suchte ich den Herrn Oberst auf.[S. 111] Er wagte zwar meine Behauptung, daß ich „Mulberry“ in Alexandrien gesehen habe, nicht zu bestreiten, versicherte aber, es einem reichen Ägypter verkauft zu haben, mit der ausdrücklichen Bedingung, das Pferd in keinem Rennen laufen zu lassen.
Nun gilt Disqualifizierung durch den Kalkutta Turf Club ebenso wie in Indien auch in Australien und in Ägypten. Um sie zu umgehen, war der Verkauf an mich mit allen Einzelheiten veröffentlicht worden. Dann kam der so glaubhafte Schlangenbiß, der durch meine, eines völlig Unbeteiligten, Vermittlung unter meinen vielen Turf-Bekannten auf völlig unauffällige Weise verbreitet wurde. Der Weg war frei, und der tote „Mulberry“ konnte für den „inneren Ring“ wieder auferstehen, um nach einigen überlegenen Siegen durch Zügelverhalten und ähnliche Leistungen die Taschen seiner unauffindbaren und unbekannten Besitzer zu füllen. Ob der englische Oberst außer Dienst zu ihnen gehörte, konnte ich nicht entscheiden. Und ob ich seine Geschichte glaubte oder nicht, war meine Sache. Aber ändern ließ sich an der Schiebung nichts, es sei denn, ich setzte ganz Indien in Bewegung. „Mulberry“ wäre dann möglicherweise zum zweiten Male gestorben und hätte mir als einziges Beweisstück für meine Behauptung recht gefehlt.
Für alle solche Sachen sind die indischen Jockeys nur allzu leicht zu haben. Englische Berufsjockeys verirren sich recht selten jenseits Suez. Die australischen Bundesbrüder und Berufsgenossen sind zu wenig entgegenkommend. Um ihre eigenen Kreise nicht stören zu lassen, dulden sie nur Australier auf den indischen Rennplätzen. Sie wissen, daß sie sich auf ihre Landsleute aus Australien in allen dunklen Renn-Machenschaften verlassen können! Sollte jemals ein nicht australischer Jockey es wagen, in Indien in den Sattel zu steigen, so scheuen die Braven aus Australien auch nicht vor einem Mord zurück. Im Flachrennen drängten sie einen englischen Berufsgenossen, der[S. 112] es gewagt hatte, nach Indien zu kommen, so an den Hang, daß er mit seinem Pferde zu Tode stürzte. Natürlich konnte man den Übeltätern nichts beweisen.
Eher gestatteten sie noch indische Jockeys als Mitreiter, denn mit ihnen ist immer eine Verständigung möglich. Auch sind sie keine Spielverderber, wenn es sich um einen Gewinn handelt. Dabei machen die Inder keine großen Ansprüche und sind im schlimmsten Falle unschwer einzuschüchtern.
In Bombay und Poona sind von arabischen und indischen Rennstallbesitzern Inder als Jockeys angestellt, meistens Mohamedaner, für arabische Pferde. Doch der Turf-Klub hat stets große Bedenken, einem Inder das Patent als Rennjockey auszustellen. Sie sind stets bestechlich und immer für unlautere Tricks zu haben. Außerdem sind sie Stümper. Sie haben weder den Verstand noch die feinen Nerven, die unerläßlich für einen Rennreiter sind. Vor allem aber haben sie kein Handgelenk. Ihre harte Faust reißt den Pferden viel zu sehr ins Maul.
So ist das indische Rennleben, von welcher Seite man auch mit ihm in Berührung kommen mag, eine recht indische Angelegenheit, erfüllt mit Lug und Trug, mit Intrigen und Geldgier. Mögen sich nun vizekönigliche Sekretäre mit Renngeschäften befassen oder mögen unwissende Inder als gelehrige Schüler bei den durch und durch verrohten Abkömmlingen früher nach Australien deportierter englischer Diebe, Mörder und Totschläger in die Schule gehen.
Nur die Pferde bleiben stets dieselben. Treu und anhänglich dem, der sie gut behandelt und ihnen mit Verstand und Freundlichkeit entgegenkommt, ob sie nun in Indien geboren sind oder aus England stammen, oder ob die freie Wüste Arabiens die Heimat ihrer Jugendjahre war. Allein die aus Australien eingeführten Tiere geben durch ihr Benehmen von der hohen Kultur seiner Bewohner Zeugnis, und es dauert stets lange, ehe sie begreifen lernen, daß es auch andere Menschen als ihre heimatlichen Rohlinge auf Erden gibt.

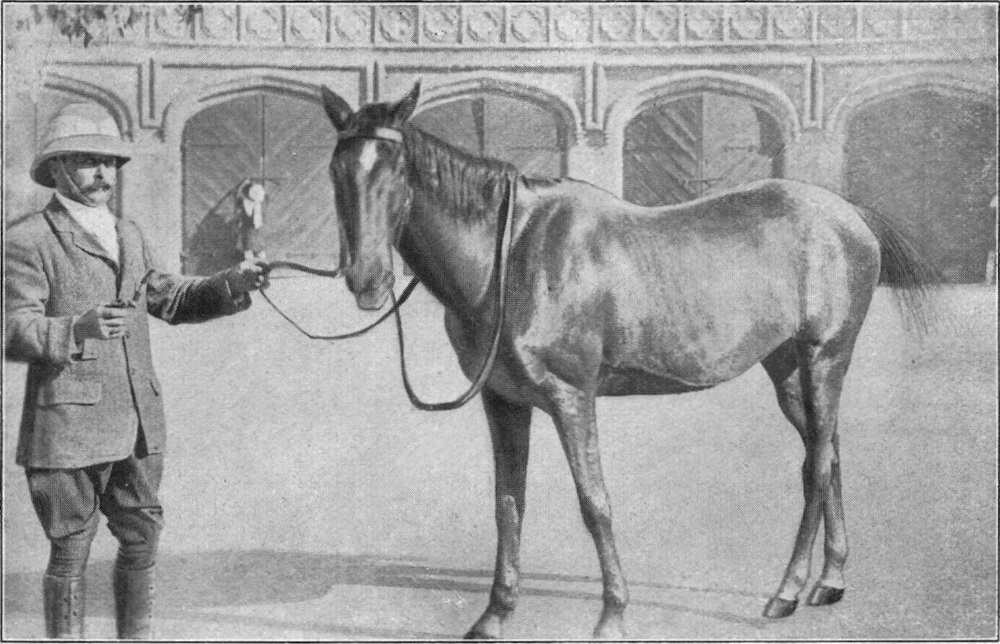

[S. 113]
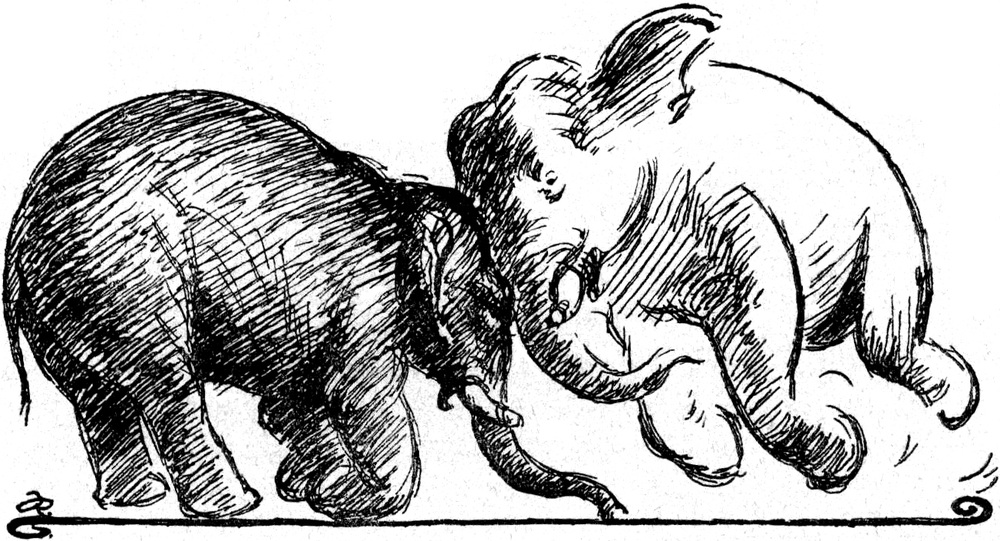
Diesen mehr von Europäern gepflegten sportlichen Betätigungen, Jagden auf Antilopen, Eberjagden und Pferderennen stellen sich mannigfache Jagdgelegenheiten rein indischen Charakters zur Seite. Eine der interessantesten ist die Falkenbeize auf Enten.
Obgleich zur kalten Jahreszeit große Züge Wildenten, besonders in den Nordwest-Provinzen Indiens einfallen, so ist es doch nicht leicht, zum Schuß auf sie zu kommen. Mit großer Vorsicht suchen sie die Mitte der Gewässer auf oder die Nähe von Ufern, die von jedem Gebüsch entblößt sind. Bei der geringsten Gefahr steigen sie auf und gehen schnell so hoch, daß sie auch für ein Rohr Nr. 4[7] nicht mehr erreichbar sind. Lockvögel, die ich aus Europa kommen ließ, verfehlten ihren Zweck.[S. 114] Die Wildente in Indien schien ihnen nicht zu trauen. Vielleicht auch, weil sie in so großer Zahl zusammenbleiben.
Die einzige Möglichkeit, mit der Aussicht auf eine größere Strecke auf sie zum Schuß zu kommen, bietet der indische Treibfalke. Nachdem die Jäger sich um das Gewässer verteilt haben, läßt der eingeborene Jagdgehilfe einen oder zwei Falken steigen. Sobald die Enten — seltener findet man, und nur auf den großen Flüssen, Gänse — den Raubvogel bemerken, fliegen sie auf und umkreisen in geringer Höhe die Wasserfläche. Bevor nun der Falke sich sein Opfer gewählt hat und darauf niedergestoßen ist, werden die über dem Wasser unruhig durcheinanderfliegenden Tiere von den Jägern beschossen. Während dieser kurzen Zeit können bei der großen Zahl der Züge hunderte von Enten erlegt werden.
Hat der Falke sein Opfer in den Fängen und bereitet sich vor, es zu verzehren, so eilt der Wärter auch schon herbei und streift ihm die Augenkappe über. Manchmal verfehlt der Falke sein Ziel, in welchem Falle er nicht wieder in die Höhe steigt, sondern sich beschämt auf einem benachbarten Felde niederläßt, von wo ihn sein Wärter durch Rufe und unter dem Schwenken eines an einem Strick befestigten Entenflügels herbeilockt. Nur selten geschieht es, daß er diesem Rufe nicht folgt. In diesem Falle muß er eingefangen werden, wobei man die Stelle, an der er sich befindet, an dem Tönen einer kleinen Schelle erkennt, die ihm angeschnallt ist.
Die Kaste der Bauri und ebenso die Bhils, eine arme, verachtete Klasse der Landarbeiter, jagen Enten auf eine einfachere Art. Da in der kalten Jahreszeit die meisten Gewässer nur wenig Wasser haben, macht der Bauri oder der Bhil sich auf, sie mit der Hand zu fangen. Nachdem er die Stelle erkundet hat, wo ein größerer Zug Wildenten eingefallen ist, bewaffnet er sich mit einem großen, irdenen Topf, dessen Seiten von Löchern durchbrochen sind, und befestigt einen Sack an seinem Gürtel. Am Wasserrande angelangt, stülpt er sich den Topf über den[S. 115] Kopf und watet, bis an die Schultern sich im Wasser haltend, langsam und vorsichtig auf die Entenschar zu. Durch Behutsamkeit und Erfahrung gelingt es ihm, mitten unter sie zu gelangen. Dann ergreift er eine nach der andern bei den Füßen, zieht sie mit raschem Griff unter die Oberfläche und erstickt sie lautlos, um sie in den Sack an seinem Gürtel zu stecken. Auf den Märkten der Nordwest-Provinzen erhält er nicht mehr als 2 Anna oder 30 Pfennig für die so gefangene Ente, weil auf diese Art erlegtes Geflügel in Indien nicht besonders geschätzt wird.
Die den Eingeborenen liebste Art, Vögel zu fangen, ist das Fallenstellen. Wachteln werden in großen Scharen durch Lockhähne unter Netzen gefangen. Die Wachteln, die auf indische Art, mit „Curry und Reis“ zubereitet, ganz besonders wohlschmeckend sind, wenn man sie nur nicht zu oft vorgesetzt erhielte, waren so zahlreich, daß man für 5 Rupien oder etwa 7,50 Mark ein ganzes Hundert lebendig kaufen konnte. In einem dunklen Raum bleiben sie lange Zeit am Leben. Der Boden wird leicht mit feinem Sand bedeckt, und die Wachteln werden nur gelegentlich in einen im Freien stehenden Drahtgitterkäfig zum Laufen herausgelassen.
Die Zeit des Wachtelfanges ist der März, wenn das Korn reift. Am Vorabend des Fanges werden in den betreffenden Feldern etwa sechs verhüllte Käfige mit Wachtelhähnen an verschiedenen Bäumen aufgehängt. Bis zum Morgen haben sich mit Sicherheit große Scharen von Wachteln, von dem Schlagen der Hähne in den Käfigen angelockt, versammelt. Zwei bis drei gute Schützen schießen in einigen Stunden mit Leichtigkeit vierzig bis sechzig Paar.
Rebhühner dagegen sind in Indien selten. Dafür gibt es die „sand grouse“; die echte „grouse“ lebt nur im schottischen Hochlande. Ihr indischer Vetter findet sich besonders zahlreich in sandiger Gegend und bietet dem geduldigen Jäger eine ebenso schmackhafte wie zufriedenstellende Beute.
[S. 116]
Das für Indien besonders bezeichnende Tier ist unzweifelhaft der Elefant. Stolz thront sein Ansehen über dem aller anderen Lebewesen. An keinem Fürstenhofe darf er fehlen. Bei allen Paraden und Prunkvorstellungen spielt er die erste Rolle. Auf seinem Rücken reitet der Herrscher unbeweglich, stolz und würdevoll durch die Menge seiner Untertanen, und in einigen Tempeln Hinter-Indiens wird dem Dickhäuter sogar göttliche Ehre erwiesen.
Mir unterstanden in Baroda über dreißig ausgewählte prächtige Tiere. Der Maharadscha von Kapurthala dagegen hatte nur etwa zwölf Elefanten in seinen Ställen.
Zu Besuch bei dem Maharadscha von Rewa im Gebiete Teraj an den Grenzen von Nepaul hatte ich einmal Gelegenheit, am Einfangen von wilden Elefanten mit Hilfe zahmer Jagdelefanten teilzunehmen. Trotzdem ich an Jagdstrapazen aller Art gewöhnt war und gern jede sportliche Möglichkeit benutzte, so würde ich es mir sehr überlegen, diese besondere Art von Jagd nochmals zu unternehmen.
Durch Treiber war eine Herde wilder Elefanten ermittelt worden. Es kam nun darauf an, ein besonders starkes, mit vollen Stoßzähnen versehenes Tier von der Herde zu trennen. Sechs von „Mahout“ — Elefantenführern — geführte zahme Tiere stehen bereit, den von seinen Gefährten abgetrennten wilden Elefanten einzuholen und einzukreisen. Es muß gelingen, ihn von allen Seiten so einzuschließen, daß er zwischen den Leibern und Stirnen der anderen wie eingemauert steht und trotz allen Widerstandes dorthin gebracht werden kann, wo man ihn haben will.
Auf dem Rücken der zahmen Elefanten liegt nur eine dünne Matte, notdürftig mit ein paar Seilen befestigt. Mehr hängend als sitzend befinden sich je zwei der Jäger, denen ich mich zugesellt hatte, auf jedem Elefanten und führen als einziges Jagdwerkzeug Ketten und Stricke mit.
[S. 117]
Das Tier, auf dem ich voller Spannung Platz genommen hatte, war eins der besten und schnellsten aus dem Stalle des Maharadscha von Rewa. Das durch die Treiber von der Herde abgesonderte Tier wurde von unseren sechs zahmen Elefanten in weitem Abstande umstellt. Und nun begann die Jagd. Der wilde Elefant bot alle seine Schnelligkeit auf, die die eines galoppierenden Pferdes übertrifft, und raste davon. Gebüsch, Bäume, Sträucher knickten wie Streichhölzer vor ihm zusammen. Ohne jedes Besinnen brach er sich durch das Dschungel Bahn. Unsere Tiere, aufgeregt und voll Eifer, jagten in gleichem Rasen hinter ihm her, suchten ihm den Weg abzuschneiden, stürmten durch peitschende Zweige, abgerissene Äste, splitternde Bäume dem wilden Bruder nach.
Wie von der brausenden Hand des Sturmes gepackt, schwankten wir auf dem Rücken unseres Tieres durch das Dschungel, über offene Stellen, durch Gebüsch und Baumbestand. Von Sitzen oder Liegen ist keine Rede. Mühsam, mit dem Aufgebot aller Energie, hielt ich mich krampfhaft an irgendeinem der dicken Stricke geklammert, welche die Matte auf dem Rücken des galoppierenden zahmen Elefanten befestigten. Im Freien, in „höchster Fahrt“ schwankte er wie ein Fischkutter im Nordseesturm. Nur nicht loslassen! Bald wurde der Körper nach oben geworfen, wenn man an irgendeinem Baume einen Ast streifte, bald fiel man in plötzlichem Sturze an der Seite des Elefanten hinab, um im nächsten Augenblick wieder nach oben geworfen zu werden. Jetzt verfing sich ein Zweig unter dem Kinn und riß einem fast den Kopf ab. Dann wieder schwamm man, nur die Hände an dem Strick festgeklammert, in einem grünen Blättermeer, das einen über den Rücken des Elefanten hob, um irgendwie wieder darauf zurückzufallen. Und ständig schwebte mir dabei die Gefahr vor Augen, an irgendeiner abgebrochenen Astspitze aufgespießt, zwischen dem Leibe des mächtigen Tieres und einem Baumstamm wie eine Fliege zerquetscht oder bei irgendeiner Wendung ganz oder teilweise zerschmettert zu werden.
[S. 118]
Und diese Hetzjagd auf den wilden Elefanten dauerte über eine Stunde; eine Stunde, wohl die längste meines irdischen Daseins, in der ich zu jeder Sekunde, ohne daß der dahinstürmende zahme Elefant es auch nur bemerkt haben würde, das Leben verlieren konnte, und das auf Arten, die selbst den überzeugtesten Selbstmordkandidaten einiges Bedenken einflößen dürften.
Endlich waren wir an den wilden Elefanten herangekommen. Wie auf Kommando lenkten die zahmen auf ihn ein, umringten ihn von allen Seiten und drängten ihre Leiber hart an den seinen. Starr und gewaltig wie Felsen schlossen die sechs riesigen Tiere des Maharadscha von Rewa ihren nicht minder mächtigen Bruder ein. Die eingeborenen Jagdgehilfen glitten zur Erde. Hin und her schwankte der Block der sieben Elefantenleiber. Wie sehr auch der Eingeschlossene drängte, sich zu befreien, die Zahmen hielten unerschütterlich stand. Zwischen den Beinen der Tiere arbeiteten die Gehilfen mit Ketten und Stricken, um die Füße des wilden Elefanten zu binden. Als dies geschehen war, wurde er langsam bis nach dem „Kedah“ — der Umzäunung — geschoben und dort bis zu seiner völligen Unterwerfung an einen starken Baum gefesselt.
Diese Stunde Elefantenhetze werde ich nie vergessen. Mein Anzug war selbstverständlich nur noch eine Erinnerung. Die Haut hing mir in Fetzen vom Gesicht, von Händen und Armen, und ich weiß nicht, von wieviel anderen Körperstellen. Ich blutete aus allen möglichen Rissen und Schrammen, und die blaue Oberfläche des Restes meines Körpers ließ nur an einzelnen Stellen erkennen, daß ich noch immer der weißen Rasse angehörte. Doch ich hatte festgehalten! Daß im wilden Dahinstürmen mir manchmal die Arme fast aus den Schultern gerissen worden waren, war mir gar nicht zu Bewußtsein gekommen. Ich hatte festgehalten! und fragte mich voller Freude, wieviel Weiße wohl jemals eine solche Urwaldfahrt mitgemacht haben mochten?
Die eingeborenen Jäger hatten wohl auch Verletzungen, Risse und Schrammen erhalten, doch viel weniger als ich. Ihre größere[S. 119] Geschicklichkeit, sich den Bewegungen des Elefantenkörpers anzupassen, gestattete ihnen, den Zweigen und Ästen leichter aus dem Wege zu gehen, indem sie sich, dicht an den Hals und Rücken des Dickhäuters geschmiegt, fest an ihn klammerten.
Der gezähmte Elefant im Stalle ist dagegen im normalen Zustande, das heißt, wenn er nicht krank oder in Aufregung ist, das ruhigste und friedlichste Tier, das man sich denken kann. Die den Elefantenwärtern, den „Mahout“, zugeteilten Jungen treiben die ganze Elefantenherde der Stallungen mühelos auf die Weide, wo sie die Tiere meistens sich selbst überlassen und ihre Zeit mit Spielen und Schlafen verbringen, bis die Herde abends wieder zurück in die Ställe muß.
Die Elefanten, die große Liebhaber von Zuckerrohr sind, beobachten die ganze Zeit über verstohlen ihre jugendlichen Hüter, um sich, sobald sie glauben, dies unbemerkt tun zu können, einer nach dem anderen vorsichtig „seitwärts in die Zuckerrohrbüsche“ zu schlagen. Sie sind aber viel zu klug, um dort zu bleiben, sondern fassen mit dem Rüssel nur so viel Zuckerrohrpflanzen, wie sie erraffen können, und beeilen sich, wieder mit der unschuldigsten Miene auf die Weide zurückzukehren. Wenn einer der Jungen den Elefanten auf seinem verbotenen Ausflug abfaßt, so läuft er mit viel Geschrei hinter ihm her, ruft ihm aus der in den indischen Sprachen so ausgebildeten Schimpfwörtersammlung die schönsten zu und schwingt weiter nichts als eine kleine Gerte, deren Hieb das Tier überhaupt nicht fühlen würde. Schuldbewußt macht der riesige Dickhäuter kehrt und eilt, seinen Platz auf der Weide wieder einzunehmen, von dem neben ihm winzigen Hütejungen angetrieben, den er, wenn er wollte, wie ein Insekt zertreten könnte.
Wenn nun auch der zahme Elefant im allgemeinen das gutmütigste und folgsamste Tier ist, so wird er unter gewissen Umständen doch zur rachsüchtigsten und gefährlichsten Bestie der Welt.[S. 120] Auch den in zu hohem Alter eingefangenen Elefanten ist nicht immer zu trauen, und es gibt selbst nach jahrelanger Abrichtung und Eingewöhnung bösartige und faule unter ihnen. Manche haben auch auf der Jagd eine unheilbare Verletzung erlitten, die sie dauernd in einer hochgradigen Reizbarkeit hält und zu jeder Beschäftigung unbrauchbar macht. Ich hatte im Staatsstall zu Baroda einen Elefanten, dem ein Tiger auf der Jagd das Ende des Rüssels abgebissen hatte. Seitdem war er nicht mehr zu benutzen. Jahraus, jahrein blieb er angekettet. Das Futter wurde ihm an einer langen Stange ins Maul geschoben, sonst wäre er verhungert. Doch trotz seiner Verstümmelung war er stets zum Kämpfen bereit und war an Gestalt und Kraft eins der stärksten Tiere des Stalles, das zu meiner Zeit kein Gegner in den Zweikämpfen bezwingen konnte, die an indischen Höfen zwischen Elefanten veranstaltet werden.
Dem gesunden Tiere kommt die Lust zum Kampfe nur in der Paarungszeit, die nicht vor dem vierzigsten Jahre eintritt. Man erkennt das Herannahen dieses Zustandes an einer wässerigen Flüssigkeit, die aus einem kleinen Riß zwischen Ohr und Auge zu sickern beginnt. Sobald dies bemerkt wird, muß der Elefant aus dem Stalle entfernt, muß in „Schutzhaft“ genommen werden, denn es überkommt ihn dann eine Art von Raserei, die man bei dem sonst so klugen und ruhigen Tiere fast als temporären Irrsinn ansprechen könnte. Der Elefant erkennt dann seinen eigenen Wärter nicht mehr. Zur Verhütung von Unfällen muß er fest angeschlossen werden, und sein Futter wird ihm auf einer langen Gabel gereicht. Von selbst nimmt er nichts zu sich.
In einem so großen Stalle, wie dem zu Baroda, tritt es öfter ein, daß mehrere Tiere zu gleicher Zeit „mousty“ werden, wie der Inder diesen Zustand nennt. Um sie für das Schauspiel eines Elefantenzweikampfes zur Hand zu haben, werden sie an einen der großen Bamiabäume, die überall gepflegt werden, in der Nähe der für diese Schaustellungen bestimmten Arena gefesselt.
[S. 121]
Soll ein solcher Zweikampf zwischen den Tieren stattfinden, so werden sie mit gelockerten Ketten, die es ihnen gestatten, mit Vorder- und Hinterfüßen kurze Schritte zu machen, in die Arena getrieben, wobei der Wärter in respektvoller Entfernung von dem Rüssel bleibt. Die hölzernen Riegel der Tore werden vorgeschoben und, an die Mauer gelehnt, stehen sich die Gegner auf etwa 200 Schritt gegenüber. Schmale Öffnungen in der aus starken Holzplanken bestehenden Umzäunung, durch die ein Mann gerade noch schlüpfen kann, gestatten, sie von den letzten Fesseln zu befreien. Sobald die Tiere dies fühlen, stürzen sie zum Angriff. Mit lautem Krachen prallt Stirn gegen Stirn. Und schon ist über die Kräfteverteilung entschieden. Der Besiegte sinkt halbbetäubt in die Vorderknie. Kurze Zeit liegt er so unbeweglich, während der Sieger sich bemüht, ihm die Stoßzähne in die Seite zu bohren. Schwer verletzen kann er ihn nicht, denn die Spitzen der Zähne sind abgesägt.
Und ehe er in seiner blinden Kampfwut wirklichen Schaden anrichten kann, springen die Wärter mit ihren Gehilfen — jeder Elefant hat einen Mahout und etwa acht bis zwölf Diener — auf das Kampfpaar zu, schießen an lange Bambusstöcke befestigte Raketen vor ihren Köpfen ab und trennen so den Sieger von seinem unterlegenen Gegner. Die behendesten schlüpfen ihm zwischen die Beine und lähmen seine Bewegungen durch das Anlegen von breiten Ringen, die innen mit scharfen Eisenspitzen versehen sind, bis es gelingt, die Hinterfüße in Ketten zu legen.
Damit ist der Kampf beendet und meistens auch der „mousty“-Zustand des Tieres. Kurze Zeit darauf zeigt der Elefant wieder sein gewöhnliches Gebaren, ist wieder ruhig, phlegmatisch und fügsam, so daß nichts mehr an ihm an den wilden Berserker der Kampfarena erinnert.
In Baroda ereignete es sich, daß einmal ein Elefant, wohl in der Erinnerung an die bitteren Erfahrungen einer früheren Niederlage, sich weigerte, den Kampf aufzunehmen. Ohne den Angriff seines Gegners abzuwarten, stürzte er furchterfaßt auf[S. 122] die mit schweren Balken verschlossene Toröffnung zu und sprang mit den Vorderfüßen auf den obersten Riegel. Da erreichte ihn der andere. Im wuchtigen Anprall versetzte er ihm einen solchen Stoß, daß er mitsamt den geborstenen Balken ins Freie flog. Nun konnte nichts mehr die beiden wutentbrannten Tiere halten, die, blind vor Erregung, der Stadt zustürmten. In den engen Straßen entstand eine unbeschreibliche Verwirrung, als die beiden gewaltigen Tiere durch die dichte Menge der Menschen rasten, hier einen Hindu mit dem Rüssel in die Höhe warfen und dort andere mit den Füßen zerstampften. Trümmer, Fetzen und formlose, zu einer unkenntlichen Masse zertretene Körper bezeichneten den Weg der beiden Ausgebrochenen. Erst nach Tagen gelang es, sie mit Hilfe anderer Elefanten wie in einer Jagd auf wilde wieder einzufangen.
Doch nicht nur eine Jagd auf Elefanten, auch eine Jagd mit Elefanten bietet Aufregung genug. In Kapurthala war mir gemeldet worden, daß sich ein Panther in die Nähe der Stadt verirrt habe. Sofort ließ ich vier der standhaftesten Jagdelefanten satteln, und lud zwei Freunde zur Jagd auf dieses doch immerhin seltene Raubtier ein.
Der Panther war in einem von ziemlich hohem Getreide bestandenen Felde aufgespürt worden. Als wir den Rand des Feldes erreicht hatten, erblickte ich von meinem hohen Sitz auf dem Rücken „Luxmis“, des weiblichen Elefanten, den ich ritt, die Schultern des Panthers in der Mitte des Getreidefeldes. Er glich an Größe einem Tiger. Die Entfernung war etwa 50 Meter. Ich legte sofort an und feuerte aus meiner .450 Expreßbüchse, dem Mahout bedeutend, auf die Stelle, wo der Panther liegen mußte, zuzuhalten.
Doch ehe ich meine Worte noch zu Ende gesprochen hatte, sprang der Panther vor uns auf und erreichte in gewaltigem Satz den Kopf meines Elefanten, beide Vorderpranken tief in die Ohren „Luxmis“ verkrallend. Entsetzt fiel der Mahout von seinem Sitz. Der Elefant war ohne Führer. Hundert andere Elefanten hätten[S. 123] sofort kehrt gemacht, und wären davongestürmt. Doch ich kannte „Luxmi“ und sie mich. Ich rief ihren Namen, um sie zu beruhigen, und spornte sie mit „Samalo“[8] und „Karero“[9] zur Tapferkeit an. Ihre Haltung war prachtvoll. Kein erschrecktes Zittern durchlief ihren schweren Körper. Mit aller Heftigkeit ihren Kopf schüttelnd, gelang es ihr, den Panther abzuwerfen, trotz der Risse, die die Krallen des Raubtieres dabei ihren Ohren zufügten. Kaum lag der Panther am Boden, als ich erneut zum Schuß kam und ihn durch eine Kugel in den Hals tot niederstreckte.
Abgestiegen, sah ich mir die Beute an und fand, daß mein erster Schuß fehlgegangen war. Ganz gegen jede Erfahrung hatte der Panther darauf uns angegriffen, denn Tiger sowohl wie Panther, die freies Feld zum Entweichen haben, ziehen fast stets vor, zu fliehen, sobald sie sich entdeckt sehen.
Luxmi, die sich bei dem fürchterlichen und überraschenden Angriff der gewaltigen Katze so überaus tapfer gehalten hatte, sah voller Genugtuung auf den toten Feind herab. Mit schrillem Trompetenton verkündete sie ihren Triumph, und es kostete Mühe, ihren Vorderfuß davon abzuhalten, den toten Panther zu zerstampfen. Trotz ihrer blutenden und in Fetzen gerissenen Ohren richtete sie sich zufrieden auf, als die erlegte Beute auf ihren Rücken gelegt wurde, und zog, den Panther allen sichtbar tragend, stolz durch die Straßen der Stadt Kapurthala, mit hocherhobenem Kopfe und sieghaften Schritten jedermann auf ihre Heldentat aufmerksam machend.
Glücklicherweise gelang es, ihre Verwundungen schnell und gründlich zu reinigen. Denn da sich zwischen den Krallen der großen Katze oft faulende Fleischreste eines früheren Opfers und andere Verunreinigungen finden, sind auch leichte Wunden, die sie verursachen, nicht ungefährlich. In dem heißen Klima Indiens ist eine Infektion des Blutes von besonders schweren Folgen und führt fast stets zum Tode.
[S. 124]
Mangelhafte Reinlichkeit ist auch mit der Grund, weshalb trotz der englischen sanitären Vorschriften es nie möglich gewesen ist, und bei der erschreckenden Indolenz der Bevölkerung auch wohl nie möglich sein wird, die jährlich unzählige Opfer fordernde Tollwut in Indien auszurotten.
Ihre Hauptträger sind überall die herrenlosen Pariahunde, die in unzähligen Mengen die Straßen jeder Stadt und jedes Dorfes bevölkern. Außer den Bauris, der verachteten Kaste, aus der die Hindu-Schikari stammen, und den kastenlosen Straßenfegern, tötet kein Hindu einen von Tollwut befallenen Hund.
Die Tiere infizieren sich an dem Unrat, den sie fressen, oder sie werden von Schakalen gebissen, unter denen diese Krankheit wohl deshalb so verbreitet ist, weil sie sich fast ausschließlich von Aas nähren.
Im April, dem Beginn der heißen Jahreszeit, tritt die Krankheit am stärksten auf. Die erkrankten, um sich schnappenden Tiere laufen durch die Menge der nur dünn bekleideten Eingeborenen und beißen naturgemäß eine ganze Anzahl. Da der Biß oft nur eine leichte, kaum schmerzhafte Rißwunde hinterläßt, beachtet die unglaubliche Stumpfsinnigkeit des Inders ihn nicht weiter, bis nach einiger Zeit die Krankheit zum Ausbruch kommt. Die britische Regierung hat wohl seit verschiedenen Jahren schon Anstalten für das Pasteursche Heilverfahren in Indien errichtet, doch die Inder, besonders die abseits der Städte wohnenden glaubens- und kastenstrengen Landbewohner, suchen sie selten auf. Schon einen Kranken ins Krankenhaus zu bringen ist schwer. Er schreckt vor den unbekannten Gefahren der Eisenbahnfahrt zurück. Seine Familie und Kastengenossen raten ab. Die Priester sind dagegen. Jeder fürchtet das Teufelswerk der Einspritzungen. Auch gibt es ja den „Garun ke Hakim“ — den Dorfdoktor —, der alles weiß! Er ist dagegen. Er weiß sicherlich, was zu tun ist. Und da er keine große Meinung von der Kunst der weißen Ärzte hat — und dies aus guten und für ihn sehr wichtigen[S. 125] Gründen —, so weiß er die Kranke zu bestimmen, sich seiner Geschicklichkeit anzuvertrauen. Soll man an der Tollwut sterben, so ist es eben so bestimmt. Weshalb sich gegen das Schicksal auflehnen?!
Unbekümmert über die religiösen Anschauungen seines Volkes, wenn es sich um seine eigene Person handelte, gab mir der Maharadscha von Kapurthala, der sehr große Angst vor der Hydrophobia, der Tollwut, hatte, unbeschränkte Schießerlaubnis gegen die Pariahunde innerhalb und außerhalb der Stadt. Auch erteilte er mir den Auftrag, durch die Bauri möglichst stark unter den Pariahunden in Kapurthala aufräumen zu lassen, ganz gleich, ob toll oder nicht. Sie wurden mit Knüppeln totgeschlagen, und für jede eingelieferte Schwanzspitze wurden zwei Anna, oder 30 Pfennig, gezahlt, so viel, wie für eine unter Wasser erstickte Ente.
Doch man konnte noch so viele töten. Die Schwanzspitzen der erschlagenen Köter konnten sich zu Haufen türmen, der Hunde in Kapurthala wurden nicht weniger. Ihre Vettern vom Lande strömten, die Gefahr nicht achtend, in Scharen herbei, um die Lücken in der Menge der Stadthunde aufzufüllen.
Dazu kam die Unredlichkeit und die vollständige Verständnislosigkeit des mit der Rechnungsführung betrauten Beamten, der auch die Prämien auszahlte. Obgleich er ein orthodoxer Hindu war, denen das Töten jedes lebendigen Wesens verboten ist, nahm er keinen Anstand, sich an dem Hundemord in Kapurthala, den der Maharadscha befohlen hatte, „gesund zu machen“.
Auch einer meiner „Tschaprassi“ — Torhüter — wurde im Schlafe vor seiner Türe von einem tollen Hunde gebissen. Ich versuchte alles, ihn zu bewegen, nach der nächsten Pasteurstelle in Dalhousie im Himalaja zu gehen. Er weigerte sich aber hartnäckig, seinen Posten zu verlassen, der zwar von keiner großen Bedeutung war und ihm viel Zeit zum Schlafen ließ, den er aber seit Jahren zu meiner Zufriedenheit ausgefüllt hatte. Da er der Kaste der Brahminen angehörte, einer höheren Kaste, ließ[S. 126] er sich von seinem „Hakim“ behandeln mit dem selbstverständlichen Erfolge, daß er eines Morgens zu mir kam — die kleine Bißwunde war längst verheilt — und mir sagte, er habe ständig einen unwiderstehlichen Drang zum Beißen, und bitte mich, sich auf sein Bett legen zu dürfen. Als ich ihm dies gestattet hatte und ihn, vielleicht eine Stunde später, aufsuchte, fand ich ihn, von seinen Kameraden, die wohl ahnen mochten, was bevorstand, so auf seinem Bett festgebunden, daß er sich nicht bewegen konnte. Als ich zu ihm trat, war die Tollwut eben ausgebrochen, Schaum stand ihm vor dem Munde. Er gab kurze, bellende und knurrende Laute von sich, fletschte mit den Zähnen, kurz, bot einen grausigen Anblick.
Von Zeit zu Zeit kehrte das Bewußtsein zurück, und er erkannte mich. In einer solchen Pause bat er mich um irgendeinen Gegenstand zum Hineinbeißen, und ich ließ ihm ein Säckchen mit Kokosfasern zwischen die Kiefern schieben, in das er sich festbiß. Gegend Abend war er tot.
Und wie er, sterben jährlich viele Tausende in Indien; aus Stumpfsinn, Unwissenheit und, für uns, lächerlichen Vorurteilen. Nichts vermag diese Leute zu rationellen Heilmethoden, die ihnen auf allen Seiten zu ganz geringen Sätzen, oft sogar umsonst, von der anglo-indischen Regierung geboten werden, zu bekehren.
Als die Beulenpest Indien mehr als dezimierte, gab es unter den über dreihundert Millionen Eingeborenen sicherlich kein halbes Prozent, das sich impfen oder von weißen Ärzten behandeln ließ.
Ebenso wie mit den Epidemien, verhält es sich auch mit den Hungersnöten, die Millionen dahinraffen. Wenn der Inder wollte, brauchte die durch das Ausbleiben des Monsunregens verursachte Dürre nicht stets die Form einer ausgesprochenen Hungersnot anzunehmen. Er will aber nicht. Lieber als auch nur eins seiner Kastenvorurteile aufzugeben, läßt er die Felder[S. 127] ohne Bewässerung; lieber sieht er sein Vieh auf den trockenen Weiden vor Durst und Hunger umkommen, als daß er es tötete, um von seinem Fleisch zu leben. Gegen den Fatalismus des Hindu — der nicht mit dem des Mohamedaners verwechselt werden darf —, gegen seinen bösen Willen, sich jeder Vernunft zu verschließen, ist auch der allmächtige „Sirkar“ ohnmächtig.
Die Regen hängen von dem Wechsel der „Monsun“ genannten stetigen Winde ab und werden in Indien durchschnittlich zur Mitte des Juni erwartet, hier etwas früher, dort etwas später. Überall aber ist die Zeit des Regenbeginns ziemlich genau infolge der Erfahrung bekannt. Für die Insel Ceylon liegt sie am frühesten, um, nach Norden fortschreitend, einen Teil Vorderindiens nach dem anderen zu erquicken.
Sollte der erwartete Regen auch nur vierzehn Tage ausbleiben, so wird die Lage des von der Hand in den Mund lebenden bettelarmen Inders, worunter wohl neunundneunzig Prozent der Landbevölkerung gerechnet werden müssen, äußerst kritisch, und zwar ganz besonders in Gegenden, die von der Bahn entfernt liegen und wo die Heranschaffung von Lebensmitteln mühevoll und zeitraubend ist.
Sicherlich tut die anglo-indische Regierung in solchen Fällen ihr Äußerstes, und sie ist stets darauf bedacht, den notleidenden Eingeborenen Hilfe zu bringen, indem sie die Bewohner der von der Dürre betroffenen Gebiete zu bewegen sucht, an den zu ihrer Unterstützung in die Wege geleiteten Notstandsarbeiten — Famine relief works — zu arbeiten, die zum überwiegenden Teil in der Anlegung von Bewässerungskanälen und Staubecken bestehen.
Doch der kastengläubige Hindu trennt sich nur äußerst schwer von seiner Scholle. Die Vorurteile seiner Religion stehen dem schroff entgegen, und manche ziehen es vor, buchstäblich Hungers zu sterben, als daß sie die Vorurteile ihres Glaubens opfern.
Dann aber kommt für die kastenlosen und gewissenlosen „Bania“ und „Schroff“ — die Getreidehändler und Geldverleiher — die Zeit der Ernte. Meistens sind sie beides in einer Person. Sie[S. 128] schließen ihre Lager und warten mit dem Verkauf des Getreides, bis der Preis um das zehnfache gestiegen ist. Als man einen von ihnen fragte, wann er denn seine Speicher den Hungernden öffnen werde, antwortete er unbewegt: „Erst, wenn sie anfangen, sich gegenseitig aufzufressen.“
Als nun dieser Zeitpunkt eintrat und er sich bereithielt, sein Getreide gegen Gold einzutauschen, waren die geschlossen gehaltenen Speicherräume leer. Die Ratten hatten sich schon das letzte Getreidekorn ohne Bezahlung angeeignet.
Wenn die anglo-indische Regierung sich bemüht, diesen Notständen entgegenzuarbeiten, so zeigen die einheimischen Vasallenfürsten wenig Verständnis für solche Maßnahmen. Sie lieben es nicht, überhaupt etwas davon zu hören. Und die einheimischen Beamten sorgen gern und mit Hingebung dafür, daß der Maharadscha keinen Einblick in diese für die Masse der Armen unerträglichen Zustände erhält. Auch ist die Bevölkerung viel zu unwissend, als in dem von allen Sorgen leiblicher Not vollständig unberührten Herrscher etwas anderes, denn den von den Göttern Auserkorenen zu erblicken und die Berechtigung seiner vollkommenen Gleichgültigkeit ihnen gegenüber irgendwie anzuzweifeln.
Als 1896 und 1900 die Hungersnot auch Kapurthala heimsuchte, begab sich der Maharadscha auf Anraten seiner Minister schleunigst auf Reisen. Es war doch auch viel wichtiger, bei der Weltausstellung in Paris anwesend zu sein, als sich mit Regierungsgeschäften zu langweilen. Daraufhin mischte sich die anglo-indische Regierung ein, um den einheimischen Fürsten und Beamten nachdrücklich vor Augen zu führen, wohin ihr nachlässiges Tun und Treiben sie führe. Ein englischer Beamter übernahm die Leitung der Staatsgeschäfte in Kapurthala unter völliger Ausschaltung sowohl des Maharadscha, wie seiner Minister und Beamten während eines vollen Jahres, was natürlich für die letzteren einen recht beträchtlichen Einnahmeausfall ergab und auch noch allerhand Unannehmlichkeiten mit sich brachte.
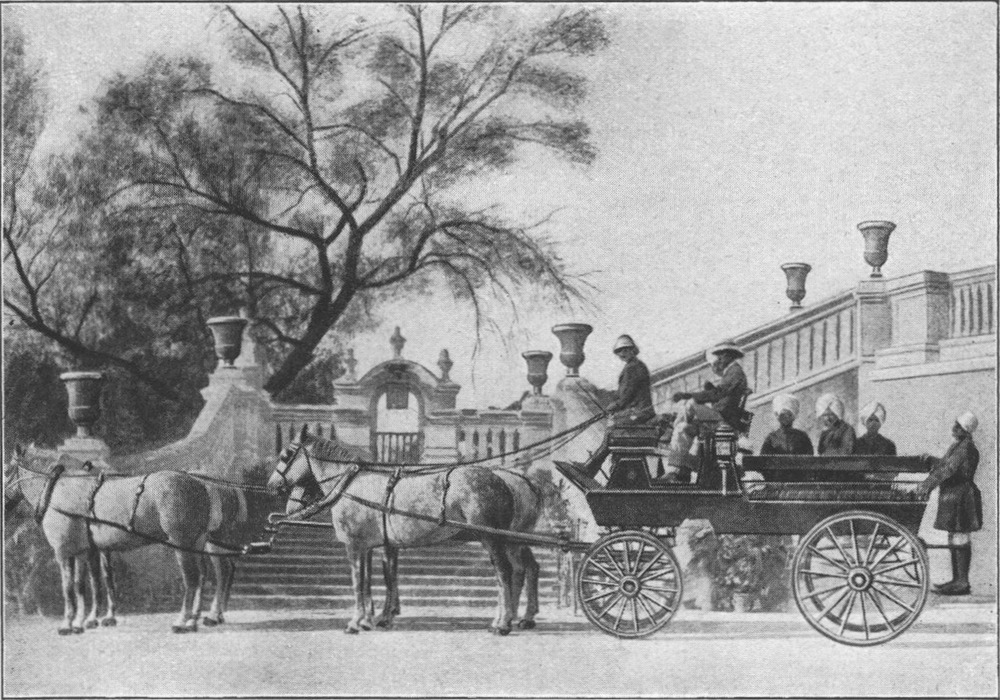


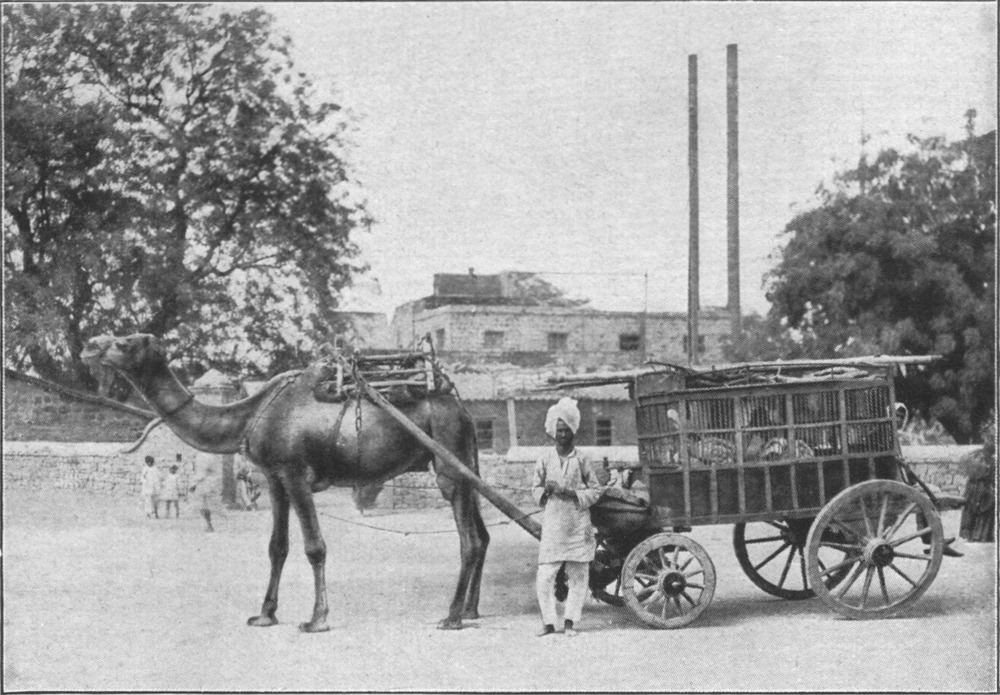
[S. 129]
Eine Reise durch eine von Hungersnot betroffene Gegend ist für jeden Weißen mehr als eine Tortur. Die zum Gerippe abgemagerten Menschen schwanken wie bewußtlose Schatten in dem heißen, hellen Sonnenlicht oder liegen teilnahmslos in irgendeiner Ecke, am Rande der Straßen, im Schatten der Häuser, und doch ist es nicht möglich, ihnen zu helfen. Viele von ihnen gehen lieber zugrunde, als ein Stück Brot aus der Hand eines kastenlosen Europäers anzunehmen, da ihre Kastenvorschriften es ihnen verbieten, Nahrung zu genießen, die Menschen außerhalb der Kastengemeinschaft berührt haben.
Mag dieser Charakter des Inders auch noch so sehr durch die Umstände seines Landes bestimmt und durch die Geschichte in seiner ganzen Unzulänglichkeit verstärkt worden sein, die Lasten, die er beklagt, hat er selbst geschaffen. Die Leiden, unter denen er seufzt, sind von seinen eigenen Händen sorgsam und liebevoll mit sonderbaren Verzierungen und verschlungenem Rankenwerk hergestellt worden. Und wer einmal Einblick in die geistige Beschränktheit, die nackte Selbstsucht und Gewinngier der großen Masse in Indien getan hat, kann der von den Engländern überall den Indern gegenüber zur Schau getragenen Überhebung, nicht nur als Mittel zum Zweck, sondern ganz objektiv durchaus nicht eine gewisse Berechtigung absprechen.
Wie Selbstsucht und Gewinngier von oben bis unten in allen Schichten der Bevölkerung vorhanden sind, konnte ich wie in einem Brennpunkt in Kapurthala beobachten.
Alljährlich fand dort eine landwirtschaftliche Ausstellung statt, bei der unter anderen auch den Besitzern des besten Pferdematerials Prämien zuerkannt wurden, die der Maharadscha in höchsteigener Person nicht zu verteilen, sondern äußerst würdevoll den ihm genannten Preisträgern in einem Leinewandsäckchen vor die Füße zu werfen pflegte.
Am Anfang meiner Tätigkeit gehörte ich, sowie zwei englische[S. 130] Tierärzte, zu dem Preisrichterkollegium dieser Pferdeschau. Jedoch, wir mußten uns sehr bald überzeugen, daß die Prämien niemals den Besitzern der von uns prämiierten Pferde übergeben wurden, sondern stets irgendeinem Anverwandten der Beamten des Maharadscha. Sie verstanden es, ohne daß wir es zu hindern vermochten, ihre Leute, die oft überhaupt kein Tier besaßen, dem Maharadscha im Augenblick der Verteilung vorzuführen, der das Geld, ohne die Empfänger auch nur anzusehen, ihnen zuwarf.
Trotz entschiedener Vorstellungen, die ich bei Dschagatdschit Singh erhob, und die ihn auch dazu brachten, mir bessere Beachtung unserer Preisurteile zuzusichern, spielte sich dieselbe Szene jedes Jahr in aller Lächerlichkeit ab. Der Maharadscha glaubte, sich durch die wegwerfende Behandlung seiner Untertanen in den Augen der anwesenden europäischen Gäste, die ihn auf seinem Zeltsessel, im Glanze seines indischen Herrschertums, bewunderten, ganz besonders eindrucksvoll zu benehmen. Zum Schluß hielten die englischen Tierärzte es für unter ihrer Würde, diese Komödie weiter mitzuspielen, und blieben der Schau fern. Ich als Deutscher sah keinen Grund, trotzdem ich Beamter des Maharadscha war, ihrem Beispiel nicht zu folgen.
Selbstverständlich verursachte dieses unser Nichterscheinen endlosen Klatsch unter der klatschlustigen Bevölkerung des Städtchens, was den anderen Beamten des Maharadscha, die nun allein mit ihren Kenntnissen Preisrichter spielen mußten, aus vielen naheliegenden Gründen wenig lieb war. Daher verfiel man auf einen kleinen, echt indischen Streich, mit dem man mich bei Dschagatdschit Singh unmöglich zu machen gedachte.
Ich war während der Tage der sogenannten Pferdeschau von Kapurthala nach Amballa zum Rennen gefahren. Diese Gelegenheit wurde benutzt, um zwei meiner eigenen Pferde den Richtern vorzuführen. Da sie natürlich an Rasse und Pflege die Tiere der armen Landbevölkerung weit überboten, wurden ihnen die höchsten Preise zuerkannt.
[S. 131]
Seiner Gewohnheit getreu, nur auf seine orientalische Potentatenwürde zu achten, bemerkte der Maharadscha nicht, wer den Preis einheimste und kümmerte sich überhaupt nicht darum, wem er die ihm überreichten Leinwandsäckchen zuwarf. So konnte ein Bengale, ein Babu, der als Beamter in meinen Diensten stand, sich der Preise bemächtigen. Man beabsichtigte, dem Maharadscha die Angelegenheit so darzustellen, als ob ich selbst, um der Preise willen, meine Pferde ausgestellt habe und mich aus diesem Grunde nicht als Preisrichter blicken ließe. Zum Glück erhielt ich gleich nach meiner Rückkehr aus Amballa Kenntnis von dem Anschlag und konnte mich bei dem Maharadscha über die Angelegenheit beklagen, ehe noch die ehrenwerten Preisrichter Gelegenheit hatten, den wohleingefädelten Plan zu vollenden und ihre Darstellung des Vorfalles dem Fürsten glaubhaft zu machen.
Um einiger Rupien willen wurde so der ganze Staatsapparat von Kapurthala in Bewegung gesetzt; alle, vom Maharadscha in seiner pomphaften Würdesucht bis zu den niedrigsten Stallburschen, waren mittelbar oder unmittelbar daran beteiligt, eine in ihren wirklichen Zwecken durchaus nützliche und richtige Angelegenheit, wie die Pferdeschau, in ihr gerades Gegenteil zu verkehren. Echt indisch muß alles der Geldgier und der Eitelkeit dienen, ohne jede Rücksicht oder Verständnis für die wirklichen Erfordernisse des Landes.
Die Prämien, die den armen und bedrückten Bauern zugute kommen sollten, und die trotz ihrer verhältnismäßig geringen Höhe für diese Leute ganz bedeutende Summen vorstellten, wurden irgendeinem nichtsnutzigen faulen Beamten in die Hände gespielt.
Inwieweit die unglaubliche Unwissenheit der Inder und ihr jeder rationellen Vernunft entbehrender Charakter — an Verstand, um die Ziele ihrer eigenen kleinen Selbstsucht mit Schlauheit und Gerissenheit zu verfolgen, fehlt es ihnen nicht — mit der dem[S. 132] Europäer ganz unverständlichen Tierverehrung zusammenhängt, habe ich, abgesehen von dem Glauben an die Seelenwanderung, nie ergründen können. Oft zwar schien es mir, als sei das eine von dem anderen bedingt.
Von der Heiligkeit der Kuh und allem Rindvieh überhaupt habe ich schon gesprochen, und mein Unverständnis mag entschuldbar scheinen, wenn die Verehrung dieser Tiere soweit geht, daß die Hindufrauen einer auf der Straße ihr Wasser lassenden Kuh von allen Seiten zueilen, um sich in dem heiligen Naß Gesicht und Hände zu waschen.
Kurz nach meiner Ankunft in Baroda war ich eines Morgens nicht wenig erstaunt, den stolzen und selbstbewußten Gaekwar in zeremonieller Gewandung seine Gemächer verlassen zu sehen, um mit tiefen Kultverbeugungen vier, auf dem Innenhofe des Palastes wartende Brahminen der Dschain-Sekte zu begrüßen. Jeder dieser Priester trug einen wenigstens zwölf Pfund schweren Sack mit Streuzucker in den Händen.
Unter dem Gemurmel einiger Sprüche berührte der Maharadscha jeden der Säcke mit der Hand, worauf die vier Brahminen in die vier Richtungen der Windrose aufbrachen, um den Zucker überall dort auf ihrem Wege zu verstreuen — wo sie auf Ameisen trafen.
In Baroda gab es auch eine Menge heiliger Affen. Eine gewisse Kaste hält sie für ebenso verehrungswürdig wie die Kuh. Diese, der Hulmanart angehörenden Affen bevölkerten in großen Herden den Palastpark, wo sie auf den vielen, schönen, großen Tamarindenbäumen lebten.
Der von mir damals bewohnte Bungalow stand mitten im Park, und als Neuling in Indien fand ich an dem Treiben der Tiere reges Gefallen. Ich begann, auf meiner Veranda sitzend, die Affen mit Brot zu füttern. Bald wurden sie zutraulich und fraßen mir aus der Hand. Nur ein altes, großes Tier, anscheinend der Anführer, wurde unmanierlich und versuchte ständig, die anderen kleineren Affen durch Kratzen und Beißen zu verdrängen.[S. 133] Eines Tages wurde er so frech, mir einen halben Laib Brot aus der Hand zu reißen und mich zähnefletschend anzugrinsen. Um die anderen nicht zu verscheuchen, wollte ich ihn nicht schlagen, beschloß aber ihn zu bestrafen und ihm eine Lehre zu geben, ohne daß die anderen es merkten.
Zu diesem Zwecke legte ich am nächsten Tage meine Luftbüchse unter meinen Sitz, so daß sie nicht auffiel, und als der Herr Ober-Affe wieder in seiner unverschämten Art zudringlich wurde, berührte ich den Abzug, um ihm mit der kleinen Kugel einen gehörigen Schrecken einzujagen. Doch anscheinend ist das Fell dieser Tiere sehr dünn, denn die Kugel mußte ihm in die Brust gedrungen sein und das Herz verletzt haben. Er griff nach der Stelle des Einschlages, schwankte dann mühsam die Stufen der Veranda hinab, gefolgt von der ganzen Schar der anderen. Es gelang ihm noch, einen der Bäume in der Nähe zu erklettern, doch nach wenigen Minuten fiel er herunter.
Die anderen hockten sich im Kreise um ihn herum, ohne einen Laut von sich zu geben. Nach einigen Zuckungen war das so unglücklich getroffene Tier tot. Nun kamen die anderen alle, einer nach dem anderen, und befühlten den Toten. Man hätte meinen können, daß sich in ihren Mienen und ihrem Gebahren Betrübnis ausdrücke. Zum Schluß zog sich einer der größeren Affen, wohl der, der ihm in der Anführerschaft folgte, zurück, und die ganze Schar schloß sich ihm an, ohne sich um den Toten weiter zu bekümmern, der von den Gartenwärtern am nächsten Morgen mit ausgekehrt und fortgeschafft wurde.
Trotz meiner damaligen Unerfahrenheit war mir die Angelegenheit sehr unangenehm, denn ich wußte wohl, was diese Affenherden für die Eingeborenen bedeuteten. Glücklicherweise aber waren nur mein „Boy“, mein Dienerjunge, und mein Koch Zeugen des Vorfalls gewesen. Ihre Angst war noch größer als meine Besorgnis vor möglichen Unannehmlichkeiten.
Da von der Angelegenheit aber nicht gesprochen wurde, hielt ich sie für erledigt, bis einige Wochen später der Gaekwar mich[S. 134] fragte, ob es wahr sei, daß ich einen heiligen Affen getötet habe. Ich schilderte ihm den ganzen Vorgang, und er versicherte mir, ihm als Maharatten würde es nur angenehm sein, wenn das ganze Affengesindel aus dem Parke verschwände. Doch da er selbst Rücksicht auf die Gefühle der Eingeborenen in Baroda nehmen müsse, warne er mich, etwas gegen diese Tiere zu unternehmen.
Irgendwie mußten die heimtückischen Brahminen, die den Maharadscha und seine Gemahlin so ziemlich in der Hand hatten, die Todesursache des Affen in Erfahrung gebracht haben und bei dem Fürsten vorstellig geworden sein.
Das eigentümlichste aber war das Verhalten der Affen selbst, die sich seit jenem Tage, während der fünf Jahre meines Aufenthaltes in Baroda, nie mehr in der Nähe meines Bungalows blicken ließen, dafür aber des Nachts auf dem Dache des Hauses den größten Lärm vollführten und möglichst viele Ziegeln loszubrechen suchten, um die Stücke auf den Weg zu werfen. Wenn ich irgendwo im Park spazieren ging und sie mich bemerkten, eilten sie von allen Seiten herbei und begleiteten mich, von Baum zu Baum kletternd, unter großem Geschrei.
Wie weit in Indien das Vorurteil, kein Tier zu töten, geht, brachte mir eine Begebenheit zum Bewußtsein, die von meinen brahminischen Feinden am Hofe zunächst in jeder Weise gegen mich zu verwerten versucht wurde.
Bei einem Spazierritt fand ich in einem Straßengraben einen Esel liegen, der das Bein gebrochen hatte und dort seinem langsamen Tod achtlos überlassen worden war. Obgleich er noch lebte, waren schon die Aasgeier und Krähen an der Arbeit, dem wehrlosen Tiere die Augen auszuhacken. Ich stieg vom Pferde und erlöste den armen Esel durch einen Schuß von seinen Leiden.
Die Brahminen aber klagten mich an und beschuldigten mich, das Tier aus Freude am Töten ermordet zu haben. Ein anwesender Buddhist ging so weit, mir vorzuhalten, daß ich so vielleicht einen Mord an meinem eigenen Großvater begangen habe.[S. 135] Erst als ich ihm antwortete, daß ich genau wisse, mein Großvater habe genügend Verstand besessen, um mir in einer solchen Lage, wie die, in der ich den Esel fand, nur herzlich für meine Tat zu danken, und daß ich bei den hohen Geistesgaben der Anwesenden nur annehmen könne, auch ihre verehrten Großväter wären nicht weniger verständig als der meine gewesen, gaben sie, in dieser Sache wenigstens, Ruhe.
Auch Schlangen werden als heilige Tiere verehrt. In Baroda werden an bestimmten Festtagen der Hindufrauen zwei bis drei Körbe mit Brillenschlangen — Kobras — in einen Saal des Tempels gestellt, wo die Frauen, hinter durchsichtigen Vorhängen versteckt, dem Schauspiel zusehen. Inmitten des Raumes stehen große, flache Schalen mit Milch, zwischen denen die Körbe Platz finden und geöffnet werden. Während die Schlangen hervorkriechen und von der Milch trinken, rufen die Frauen ihre Götter an, die der Anblick der Schlangen besonders günstig stimmen soll.
Den priesterlichen Schlangenbeschwörern ist es ein leichtes Spiel, die dick mit Milch vollgepumpten Tiere wieder in ihre Körbe zurückzubringen. Eigentlich sollen sie, gemäß den Vorschriften der heiligen Bücher, nach beendeter Feier wieder in Freiheit gesetzt werden, doch für die Brahminen ist es einträglicher, sie an herumziehende Gaukler zu verkaufen, die dem Volke ihre Schlangenbeschwörerkünste zeigen.
Diese gewöhnlichen Schlangenbeschwörer unterliegen aber bei ihren Künsten größeren Gefahren, als ihre priesterlichen Berufsgenossen. So hatte einst ein alter, sehr bewährter Mann dieser Sippe im Garten des Maharadscha von Baroda eine große Kobra gefangen. Er bat, dem Fürsten und seinem Gefolge die Kunst zeigen zu dürfen, mit einem so giftigen und gefährlichen Tier ohne jede Dressur umzugehen. Als wir uns alle eingefunden hatten, handhabte er die Schlange in der verschiedensten Weise. Plötzlich aber erhielt er von dem Tier einen Biß in den Unterarm. Er[S. 136] schleuderte die Kobra zu Boden, wo sie schnell von den Umstehenden zertreten wurde. Er selbst jedoch bat flehentlich, der Maharadscha möge doch einem der Leibwächter gestatten, ihm mit seinem scharfen Krummsäbel den Arm am Ellbogen abzuschlagen. Der Gaekwar nickte, und eine Sekunde später lag der Unterarm des Mannes auf dem Teppich, das einzige Mittel, dem unvorsichtigen Schlangenbeschwörer das Leben zu retten.
Mit dem früheren Emir von Afghanistan, Jakub Khan, der eine sichere Pension der anglo-indischen Regierung dem unsicheren Throne in Kabul vorgezogen hatte, dessen Inhaber, ob gut oder schlecht, ob grausam oder wohlwollend, durchgängig ermordet enden, war ich eines Tages auf einem Jagdausflug in den Dschungeln von Dehra Dun, am Fuße des Himalajagebirges, begriffen, als plötzlich unser Mahout entsetzt rief: „Eh Schaitan utter hai! — Dort ist der Teufel!“
Der Emir und ich saßen zusammen in einer Jagd-Howdah auf dem Rücken eines Elefanten. In dem Dämmerlicht, unter dem dichten Laubbestand der Bäume, konnten wir nicht sogleich feststellen, was den Schrecken des Führers, der vor uns auf dem Nacken des Dickhäuters saß, veranlaßt hatte. Den Mann mit guten Worten beruhigend, damit er in seiner Furcht vor dem Teufel nicht seinen Sitz verließe und uns so ziemlich hilflos den Launen eines führerlosen Elefanten ausliefere, gelang es uns endlich, zwischen den Baumstämmen die Ursache seines Ausrufes zu entdecken.
Von einem schräg ragenden starken Ast hing ein ungeheuer dickes, geschwollenes Etwas herab, das sich mit einer zweiteiligen braunen Kralle an dem Baume festhielt und in den wunderbarsten Schwingungen und Verrenkungen einen lautlosen Tanz in der Luft vollführte. Sonderbar glänzende Schatten, gelbbraun, schwarz und dunkelgrün, liefen über die lange, runde Form der gliedlosen Gestalt.
[S. 137]
Wir ließen den Elefanten vorsichtig näherschreiten, der, den erhobenen Rüssel aufgeregt hin und her bewegend, leise Töne des Unbehagens ausstieß. Plötzlich sah ich, daß das, was uns als Kralle erschienen war, verzweifelte Ähnlichkeit mit dem gekrümmten Gehörn eines Antilopenbockes hatte, und gleichzeitig bemerkte ich, daß dies Gehörn, mit einem Teil des dazugehörenden Kopfes, aus dem Rachen einer Schlange ragte. Es war eine „Python“, eine Riesenschlange, die beim Verschlingen des Antilopenbockes bis zu dem Kopf ihres Opfers gelangt war und nun, wegen des großen Gehörnes, die Beute sich nicht weiter einzuverleiben vermochte. Sie war daher auf einen Baum gekrochen, hatte die hakenförmigen Hörner der Antilope zwischen zwei starke Äste geklemmt und sich mit ihrer ganzen Last herunterfallen lassen, um die Hörner, die sie am restlosen Verschlingen der Beute hinderten, abzubrechen oder doch soweit zu lockern, daß sie sie im Rachen vom Kopfe des Tieres abbrechen konnte.
Ein Kopfschuß ließ die Schlange sich aufbäumen, und mit dem Gehörn im Rachen fiel sie tot zu Boden. Sie war über fünf Meter lang und bot, mit dem bis zum Hals verschlungenen Antilopenbock im Leibe, sicherlich einen furchterweckenden Anblick, der im ersten Augenblick so unerklärlich erschien, daß der Ausruf unseres Mahout wohl berechtigt war. Wenn der Teufel so aussieht, wie diese Antilopenhörner tragende Pythonschlange, muß er allerdings ein recht wenig angenehmer Geselle sein!

[S. 138]

Als der berühmte amerikanische Schriftsteller Mark Twain Indien besuchte, traf ich mit ihm in Gwalior zusammen. Auf den humorvollen Spott, der seine Bücher besonders charakterisiert, anspielend, fragte ich ihn im Laufe unserer Unterhaltung, wie er wohl glaube, den indischen Verhältnissen und den indischen Menschen in dieser seiner besonderen Weise gerecht werden zu können; denn trotz meiner langjährigen Anwesenheit in Indien und meines ständigen Verkehrs mit Indern wäre mir noch nie irgend etwas, das mit Humor auch nur verwechselt werden könne, zur Kenntnis gekommen.
Mark Twain überlegte meine Worte in seiner ruhigen Art und gab mir dann zu, daß er selbst noch keinen Weg sehe, die indische Welt irgendwie in humorvollen Darstellungen dem europäischen oder amerikanischen Verständnis näher zu bringen. Aus[S. 139] den Erzählungen von Leuten, die wie ich viele Jahre in Indien gelebt hätten, und aus den Beobachtungen seines eigenen Aufenthaltes habe er so viel Unergründliches gesehen und wahrgenommen, daß er es nicht wagen würde, die so sonderbaren Umstände und die von der unseren so ganz verschiedene Auffassung und Denkweise auf seine Art zu schildern. Ihm selbst beginne klar zu werden, daß, je länger man in Indien lebe und je enger man mit der eingeborenen Bevölkerung in Berührung komme, man destomehr begreifen lernen müsse, wie auch in dem seltsamsten Tun und Treiben dieser Menschen, von ihrem eigenen Standpunkte aus, sicherlich nichts Außergewöhnliches zu finden sei. Alles Sonderbare dort, was unserem Gefühl und unserer Ansicht nach oft kaum noch mit dem Maßstab gesunder Vernunft gemessen werden könne, werde, im Winkel indischer Verhältnisse gesehen, wenn auch nicht für uns natürlich, so doch verständlich, da die ganzen Grundlagen des indischen Lebens uns beständig neue, fremdartige und unbegreifliche Ausblicke erschlössen.
Ich bin trotz meiner zwanzig Jahre in Indien, die mir Einblicke in das einheimische Leben und in die Verhältnisse von Land und Leuten gestatteten, wie sie wohl nur wenigen Europäern vor mir möglich waren, nicht in der Lage, ein irgendwie abschließendes Urteil oder auch nur eine vollständig objektive, wahrheitsgetreue Darstellung dieser Dinge zu geben. Auch bei den sonderbarsten Vorfällen, über deren Ursprung, Verlauf und Ende mir alle Einzelheiten bekannt waren, mußte ich immer wieder sehen, daß letzten Grundes stets wieder eine Tatsache, eine Anschauung, ein Begriff, ein Glaube mitspielte, deren Vorhandensein mir unbekannt geblieben war. Dieses Unergründliche der tausendfachen Verschlingungen und Verästelungen des indischen Lebens, die heterogene Mannigfaltigkeit des Daseins dieser Hunderte von Millionen Menschen, ihre vieltausendjährige, unbekannte und in[S. 140] der seltsamsten Weise verwischte Geschichte, die außerordentliche Verschiedenheit der geographischen Bedingungen, unter denen sie leben und deren Auswirkungen in der unverständlichsten Weise sich kreuzen, durcheinanderlaufen oder sich überlagern, machen das Leben der einheimischen Inder zu einem dem Europäer vollständig unentwirrbaren Irrgarten. Nur Einzelbilder, Ausschnitte können gegeben werden und auch diese Schilderungen bleiben stets unvollständig, weil ihre wirklichen Ursachen und ebenso ihre mittelbaren Folgen im Dunkel des Unbekannten sich verlieren.
Es ist mir daher stets unbegreiflich geblieben, wie so viele Weltreisende, die sechs oder zwölf Monate auf das „Studium“ Indiens verwenden oder das Land zum Vergnügen durchquert haben, in den Schilderungen ihrer Reiseerlebnisse gewissenhaft auch die Sitten und Gebräuche, die Moral und Ethik seiner Bewohner ausführlich behandeln. Selbst so berühmte Schriftsteller wie Rudyard Kipling oder die vielgelesene Marion Crawford geben in ihren Büchern oft genug schiefe Bilder auch der Einzelheiten des indischen Lebens.
So erwähnt zum Beispiel Kipling in seinem Buche „Kim“, wie ein gewisser, von ihm Surkan Sahib genannter Mann, auf den ich später noch zurückkommen werde, der indischen Regierung als Geheimagent die größten Dienste geleistet habe. Dieselbe Person hat Marion Crawford zum Vorbild des herrischen Helden ihres Buches „Mister Isaacs“ genommen. In Wirklichkeit war dieser Mann, den ich selbst gekannt habe, ein armenischer Eunuch aus Konstantinopel, ebenso häßlich wie habsüchtig, dessen Gerissenheit in Indien nicht ausreichte, ihn davor zu schützen, von der Höhe eines ergaunerten Reichtums wieder zurück in das tiefste Elend zu sinken.
Wenn ich daher im folgenden einige Erzählungen aus dem Leben indischer Menschen gebe, so sind die sich daraus ergebenden Rückschlüsse eines Europäers niemals die, die ein Inder aus ihnen ziehen würde. Was uns lächerlich, abstoßend, oft auch wohl direkt dumm und kindisch erscheint, hat für den Inder nichts[S. 141] Auffälliges, da es sich für ihn als natürliche Folge ganz selbstverständlicher Umstände ergibt. Ja, in gewissen Fällen ist das, was uns wie ein mehr oder weniger guter Witz berührt, dem Inder höchste Tragik.
Alle Vorkommnisse in Indien sind enger oder weiter stets mit dem komplizierten Kastenwesen verbunden. Selbst mir nun, der ich als Beamter in den Vasallenstaaten gezwungen war, mich so eingehend wie nur durchführbar damit vertraut zu machen, um die religiösen Begriffe der mich umgebenden Menschen, Vorgesetzte, wie Diener und Untergebene, nicht zu verletzen, ist es nicht möglich, auch nur einigermaßen verständliche Überblicke über diese verwickelten Verhältnisse zu geben. Nur eins kann ich sagen: von allem, was ich in Indien gesehen habe, haben mir die Kastenvorschriften den Inder am verächtlichsten gemacht. Dies nicht so sehr deshalb, weil ich als Christ Vorschriften ablehnend gegenüberstehe, die aus der Gleichheit aller Menschenkinder vor den grundlegenden Pflichten des inneren Selbst eine Phantasmagorie der unmöglichsten zwischen-menschlichen Beziehungen machen, sondern besonders deshalb, weil sie meiner Überzeugung nach nur berechnete und berechnende Heuchelei sind, um die Armen, die Unwissenden und die Ungebildeten bis aufs Blut auszusaugen. Vielleicht mag ich Unrecht haben, doch meine vieljährige Erfahrung hat mir die Meinung aufgezwungen, daß der Hinduglaube dem Durchschnitt seiner Anhänger jedes Gefühl für Ehre, für Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit raubt und ihn in Heuchelei, Lüge und Falschheit versinken läßt.
Die Inder, die mir durch Mut und Frische noch am meisten Achtung abgezwungen haben, sind die Radschputen, die Sikh, und die den Radschputen am nächsten stehenden Dogra; dann die Maharatten, allerdings nur im Sport, und vor allem die Mohamedaner. Unter den Letzteren wieder zeichnen sich besonders die[S. 142] Rohilla, die Afghanen, die verschiedenen Stämme der Nordwestprovinzen, die Afridis, die Tschitrali und einige Belutschi durch männliche Eigenschaften aus. Die Gurkha, von den Indern „Goralog“ — Soldateska — genannt, sind keine eigentlichen Inder. Sie sind Buddhisten und ähneln in den Gesichtszügen und der Gestalt mehr den Tataren. Ihre Heimat ist Nepaul, von wo sie entgegen dem Willen ihres Herrschers, des Maharadscha Schamser Yang, über die Grenze nach Indien wandern, um sich in der britisch-indischen Armee anwerben zu lassen. Die englisch-indischen Militärbehörden stellen diese unerschrockenen, tapferen Leute gern in die besonders gebildeten Gurkharegimenter ein. Ohne die Hilfe dieser Truppen wäre es den Engländern oft schlecht ergangen. Schon bei dem so weit zurückliegenden großen indischen Aufstand 1857/58 und während der verschiedenen afghanischen Kriegszüge bildeten die Gurkharegimenter den festen Kern der Eingeborenentruppen.
Diese Tatsache ist den Gurkhakriegern wohlbekannt, und sie beanspruchen, den weißen, englischen Soldaten gleichgestellt zu werden. Daher ist der englische Generalstab darauf bedacht, sie der Führung von nur ausgesucht tüchtigen englischen Offizieren zu unterstellen, gehört doch viel Takt und Erfahrung dazu, mit ihnen auf die richtige Art und Weise umzugehen. Da die Gurkha ebenfalls aus dem Hochgebirge stammen, machen sie Anspruch darauf, mit den schottischen Hochländern, die als englische Elitetruppe gelten, gleichgestellt zu werden. Deshalb ist die Armeeleitung stets darauf bedacht, in den ständigen Grenzkriegen mit den fanatischen, mohamedanischen Stämmen, die in der Gegend des Kyberpasses wohnen, die Gurkharegimenter stets Seite an Seite mit Abteilungen der schottischen Hochländer anzusetzen, um die gegenseitige Eifersucht der beiden auszunützen, die sich in draufgängerischer Tapferkeit zu überbieten suchen.
Die Lieblingswaffe der Gurkha ist der „Kukri“, ein schweres, großes, krummes Messer, das sie meisterhaft zu handhaben verstehen, um dem Gegner den Leib aufzuschlitzen.
[S. 143]
Unter den schlauen, skrupellosen und geriebenen Indern ist der schlaueste, skrupelloseste und geriebenste sicherlich der der höchsten Priesterkaste angehörende Brahmine. Außer dem einträglichen Geschäft eines Hindupriesters stehen den Angehörigen dieser Kaste auch die höchsten Staatsämter offen. In den Vasallenstaaten sind die meisten Minister Brahminen. Und auch in den, der britischen Verwaltung unterstehenden Gebieten wissen sie es oft zu der Stellung von Richtern und Steuerkommissaren zu bringen, die ihrer Habsucht ebenfalls gute Aussichten bieten. Auch unter den eingeborenen Lehrern und den Angestellten der großen Handelshäuser findet man nicht selten Brahminen.
Sie verachten jede Handarbeit als gemein. Jedoch das ebenfalls recht einträgliche Geschäft des Bettelns ist ihnen nicht verwehrt. Wer würde es auch wagen, den von den Göttern geliebten Angehörigen der hohen Brahminenkaste eine Gabe zu verweigern? Ihr Fluch würde den Frevler sehr bald erreichen.
Ein Brahmine darf nichts essen, was Leben gehabt hat.[10] Seine Mahlzeiten muß er zu bestimmten Zeiten einnehmen, und kein Angehöriger einer anderen Kaste darf zugegen sein. Die Speisen selbst darf nur jemand der eigenen Kaste zubereitet haben, und er darf Wasser nur aus solchen Brunnen trinken, die für seine Kastengenossen bestimmt sind und aus denen es von solchen geschöpft worden ist. Hierzu aber treten noch eine große Menge ähnlicher Vorschriften, die sich in gleicher Sorgfalt mit allen anderen Lebensverhältnissen des Brahminen befassen. Trotzdem aber haben nicht wenige hohe Beamte, die dieser Kaste angehören, an meinem Tisch, ganz ohne Rücksicht auf irgendwelche Vorschriften, es sich wohl sein lassen.
[S. 144]
Zwar ist der Brahmine von den übrigen Hindu ebenso gehaßt wie gefürchtet. Doch die in der Hauptsache von ihnen verfaßten Hinduvorschriften verbieten es wohlweislich, das Blut eines Brahminen zu vergießen. Dies hindert jedoch die anglo-indische Regierung nicht, auch einen Brahminen bei Gelegenheit aufzuhängen. Ein früherer Holkar von Indore half sich in der Weise, wenn ihm einer seiner Brahminen-Minister zu lästig wurde, daß er, um nicht an den Hinduvorschriften seiner Maharattenkaste zu freveln, ihn in ölgetränkte Tücher einwickeln und verbrennen ließ.
Der Geiz der Brahminen, wie überhaupt des Inders — ausgenommen die Fürsten — ist unersättlich. Lieber läßt er sich unter den größten Qualen töten, als daß er das Versteck angäbe, in dem er sein Vermögen verborgen hält.
In Kapurthala war ein brahminischer Minister, Duma Mall. Er hatte sich auf Rechnung des Fürsten und der Bevölkerung so bereichert, daß es ganz allgemein hieß, er verheimliche mehr Geld als der Maharadscha je gesehen habe. Trotzdem pflegte er am Morgen unter dem Bamia-Baume vor seinem Hause zu sitzen und mit einem Rasiermesser Streichhölzer zu spalten, um anstatt eines deren zwei zu haben.
Eines Tages überfiel ihn nun eine schwere Krankheit, und er schloß sich in dem dunkelsten Zimmer seines Hauses in der Stadt Kapurthala ein, wo er sich von dem eingeborenen Doktor, dem „Hakim“, behandeln ließ. Obgleich er niemanden vorließ, konnte er meinen Besuch, den ich ihm im Auftrag des Maharadscha abstattete, nicht gut abweisen. Als ich das Loch, das er als Krankenzimmer gewählt hatte, betrat, begann er sofort, sich zu beklagen, daß der Fürst die treuen Dienste seines treuesten Dieners anscheinend ganz vergessen habe.
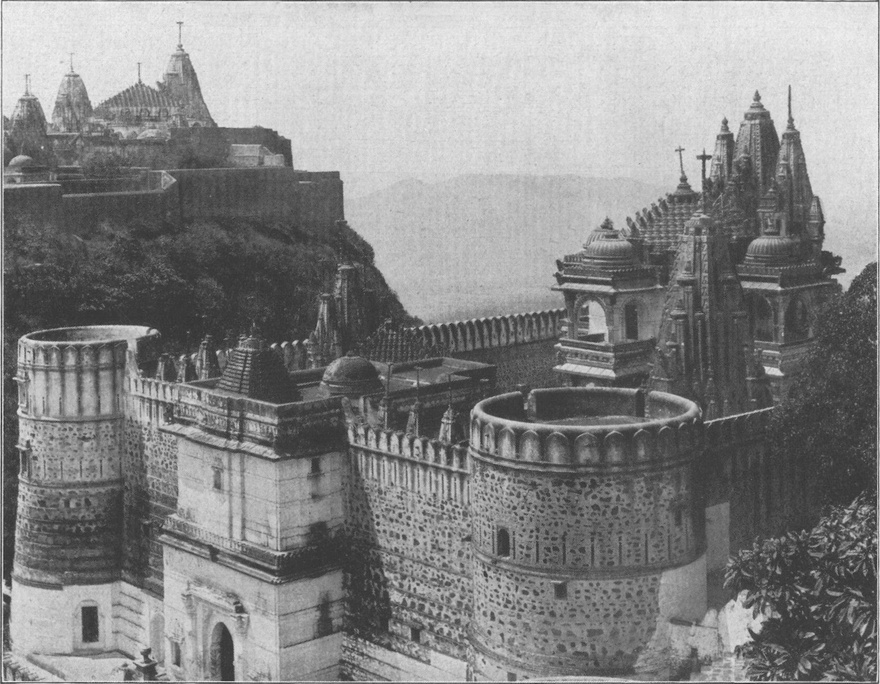

Als ich ihm entgegnete, daß gerade mein Besuch das Gegenteil beweise und daß Dschagatdschit Singh das größte Interesse an seiner baldigen Genesung nähme und ihm deshalb riete, diesen[S. 145] dumpfen Platz zu verlassen und sich an die Meeresküste zu begeben, um dort in frischer Luft und unter guter ärztlicher Pflege bald wieder gesund zu werden, versprach er, diesen Rat zu befolgen.
Vorher, sagte er, müsse er aber von einem Zahnübel geheilt werden. Seine Zähne nämlich begännen alle sich zu lockern, und dazu müsse der englische Zahnarzt aus Lahaur nach Kapurthala kommen. Doch dies koste viel zu viel für einen so armen Mann, wie er es sei, und ich möchte doch dem Maharadscha vorschlagen, diese Kosten zu tragen.
Als ich Dschagatdschit Singh über meinen Besuch bei Duma Mall Bericht erstattete und ihm den Wunsch des kranken Brahminen-Ministers vortrug, gab er mir zur Antwort, daß er gar nicht daran denke, auch nur eine Anna für diesen elenden Geizhals auszugeben, der ihn sicherlich ganz ausreichend bestohlen habe.
Als nun Duma Mall diese Absage des Fürsten erfuhr, verfiel er in so tiefen Gram, daß er am folgenden Tage starb. So wenigstens berichteten die Erben, die aber die größte Mühe hatten, das hinterlassene Vermögen aufzuspüren. Erst nach und nach kamen ganze Kisten mit Rupien und Kostbarkeiten aller Art aus den sonderbarsten und unwahrscheinlichsten Verstecken zum Vorschein. Der Maharadscha gedachte nun, einen Teil dieses ihm gestohlenen Reichtums für seine Privatschatulle zu beschlagnahmen. Aber die Kniffe der Erben, die sich mit den anderen Staatsbeamten zu „verständigen“ wußten, vereitelten die Maßnahmen Dschagatdschit Singhs, und es gelang den Erben, den ganzen Schatz auf britischem Gebiet in Sicherheit zu bringen.
Der Versuch des Maharadscha, auf diese Weise wieder in den Besitz von Summen zu gelangen, um die man ihn bestohlen hatte, veranlaßte aber seine anderen Beamten, die wohl Grund hatten, gleiche Maßregeln aus gleichen Gründen befürchten zu müssen, ihre unterschlagenen oder sonstwie auf unehrliche Weise zusammengescharrten Gelder schleunigst über die Grenzen zu schaffen. Sie legten sie in Landgütern und Grundstücken auf britischem Gebiet an, wo der Maharadscha von Kapurthala keine Macht oder Gerichtsbarkeit[S. 146] mehr besaß. In Banken setzen die Inder wenig Vertrauen, was bei dem allgemeinen Mangel an Ehrlichkeit und dem berechtigten Mißtrauen, das ein jeder dem anderen entgegenbringt, auch nicht verwunderlich ist.
Sonst ist es bei den indischen Fürsten die Regel, ihren Untertanen nicht zu erlauben, sich in ihren Vermögensverhältnissen über einen bescheidenen Durchschnitt zu erheben.
Bei dem unglaublichen Geiz der Inder kommt es oft vor, daß sie das Geheimnis des Verstecks ihrer vergrabenen oder sonstwie verborgenen Schätze mit ins Grab nehmen. Kein Suchen, keine Nachforschung der Hinterbliebenen hilft, der Erbschaft auf die Spur zu kommen. Die Lehmwände der Häuser werden eingerissen, die Gärten umgegraben, doch nirgends ist eine Spur des in der Einbildung der jammernden Erben immer größer werdenden Schatzes zu finden. Zu gut ist das Versteck gewählt, zu abgelegen der Ort, den der Tote bei seinen Lebzeiten mit dem Aufgebot seines ganzen Scharfsinns ausgewählt hat.
Auf diese Weise verschwinden in Indien jährlich nicht unbedeutende Summen, die mit den ganz allgemein in sicherem Versteck aufbewahrten Schätzen, die im Lande in Umlauf befindliche Menge an Gold und Silber stark vermindern, welcher Umstand wiederum nicht ohne Einfluß auf die Rupienwährung bleibt. Der Geiz der Inder hat also auch seine volkswirtschaftlichen Folgen, und trägt dazu bei, die Armut der großen Masse der Bevölkerung noch ausgesprochener zu machen.
Doch bei der allgemeinen Unwissenheit und bei der Unfähigkeit auch der sogenannten gebildeten Inder, in anderen Formeln als rein persönlichen, selbstsüchtigen zu denken, worin ihnen allerdings auch ein recht bedeutender Teil der weißen Bevölkerung in Europa und Amerika ziemlich nahe kommt, ist es nicht wahrscheinlich, daß sie, um ihnen so fern liegender allgemeiner Vorteile willen, jemals davon abgehen werden, ihre Gold- und Silbermünzen als das zu behandeln, was sie sind oder doch sein sollten, nämlich als Tauschmittel.
[S. 147]
Und wenn schon im Praktischen der Inder sich so stark von den Grundlagen fortschrittlicher europäischer Wirtschaft entfernt, wie sollte er sich dann westlichen Anschauungen gefühlsmäßiger Art zu nähern vermögen?
So wie ich in meinem langjährigen Aufenthalt in Indien den indischen Charakter kennengelernt habe, bin ich zu der Überzeugung gekommen, daß ihm die grundlegenden menschlichen Leidenschaften, von denen in Europa in so großem Maßstab das Glück oder Unglück der Menschen bestimmt wird, fremd sind. Die Liebe, sowohl die der aufrichtigen, ruhigen, gegenseitigen Form, wie als Leidenschaft, die das ganze Schicksal eines Menschen in ihren Bann schlägt, ist ihm vollständig fremd. In ähnlicher Weise sind auch Ehrgeiz und Ruhmsucht, Streben nach ideellen Gütern um ideeller Werte willen, Selbstlosigkeit, Aufopferung und alle die in tausend verschiedenen Abstufungen das Leben europäischer Menschen bestimmenden Einflüsse für den Inder ohne jede Bedeutung. Die Empfindungen, die ihn bewegen, unterliegen für den Inder ganz anderen Voraussetzungen.
Der Durchschnitts-Inder ist von einer trägen Indifferenz beherrscht. Das hindostanische Sprichwort: „Es ist besser zu sitzen als zu stehen, — besser zu liegen als zu sitzen, — besser zu schlafen als zu wachen“, drückt vielleicht am klarsten und verständlichsten die für den größten Teil der indischen Bevölkerung gültige Lebensweisheit aus.
Selten erreicht ein Inder ein hohes Alter, was wohl besonders mit dem frühen Heiraten zu tun haben mag. Kann man doch schon zwölfjährige Kinder als Mütter sehen. Im achtzehnten Lebensjahr sehen viele weibliche Wesen schon verlebt aus, und eine Frau von fünfundzwanzig ist in Indien nicht selten Großmutter. Der männliche Inder steht ebenfalls mit dreißig Jahren schon an der Grenze seiner Leistungsfähigkeit, und es ist selten, daß er sechzig Jahre alt wird. Hierzu kommt die außerordentlich sinnliche[S. 148] Veranlagung des Inders, die sich, ohne jede Schranken zu kennen, auslebt. Von den jungen Männern, die ich gekannt habe, gab es nur wenige, die mit 16 und 17 Jahren nicht schon geschlechtskrank waren, wobei noch zu beachten ist, daß derartige Krankheiten in Indien von den damit Behafteten mehr als eine Auszeichnung, denn als gesundheitsschädigende Leiden empfunden werden.
So sind die Heiraten in Indien fast durchgängig Vernunftheiraten. Auch wenn der Maharadscha von Kapurthala sowie eine Anzahl anderer Vasallenfürsten es zu bewerkstelligen verstanden, ihre Zenana durch eine weiße Frau zu bereichern, oder wenn sie sich bemühen, auf ihren Reisen mit weißen Frauen anzuknüpfen — wobei sie in den meisten Fällen doch betrogen werden —, so geschieht dies vielmehr, um gegenüber ihren Stammesgenossen mit ihren Eroberungen prahlen zu können, als daß irgendeine persönliche Neigung dabei in Frage käme. Auch bezwecken sie damit vor allem, den Engländern zu zeigen, welche Erfolge sie, die verachteten „dreckigen Neger“, bei dem weißen weiblichen Geschlecht zu erringen verstehen. Nichts machte dem Maharadscha von Kapurthala mehr Vergnügen, als wenn er dem allmächtigen britischen Sirkar auf diese Weise seine Überlegenheit beweisen zu können glaubte, besonders, wenn er aus irgendeinem Grunde wegen Mißgriffen in seinen Regierungsangelegenheiten zur Rede gestellt worden war.
Er wurde deshalb auch von der englischen Gesellschaft recht nachlässig behandelt, ausgenommen man konnte sich auf seine Kosten bereichern. Großen Verdruß bereitete es ihm jedoch stets, wenn, was oft geschah, ein eingebildeter junger englischer Leutnant in Gegenwart aller Eingeladenen mit dem Hut auf dem Kopf auf ihn, den hohen indischen Fürsten, zutrat und ihm mit einem nachlässigen: „How do you do, Rajah?“ (Wie steht’s Radscha?) die Hand schüttelte. Dschagatdschit Singh empfand dies stets als[S. 149] einen groben Schimpf und fühlte sich schwer beleidigt. Wenn er mir dann des langen und breiten sein Leid klagte und ich ihm riet, doch bei der ersten Gelegenheit ein so ungehöriges Benehmen zurückzuweisen, so nahm er sich wohl stets vor, meinen Ratschlag zu befolgen, ohne doch auch nur einmal den Mut dazu aufbringen zu können.
Um in dieser Hinsicht den Engländern möglichst gleichzukommen und sie, oder wenigstens doch seine Standesgenossen, zu übertreffen, war dem Maharadscha von Kapurthala nichts zu teuer. Teilweise aus diesem Grund und dann auch, um dem Kaisar-i-Hind zu beweisen, wie sehr er der britischen Regierung ergeben sei, sandte er mich einige Monate vor den Krönungsfeierlichkeiten des Königs Eduard VII. nach Paris, um dort eine dem Ansehen seiner Würde entsprechende Staatskarosse zu erstehen, die während der Abhaltung des Krönungs-Durbar alle anderen an Glanz und Pracht übertreffen sollte. Er gab mir den Auftrag, besonders darauf zu achten, daß mit dem Anbringen des fürstlichen Wappens, das oben eine siebenzackige Krone hatte, nicht gespart würde. Dieses Wappen sollte, in besonders großen Schildern, an allen dazu geeigneten Plätzen an dem Wagen wie am Geschirr angebracht werden. Ich ließ diesen Wagen in Paris bei der Firma Rothschild bauen, und das Gefährt fiel zur vollsten Zufriedenheit aus. Es übertraf in der Tat alle anderen Wagen durch seine elegante und geschmackvolle Ausstattung. Nebenbei hatte mir der Maharadscha noch einen Auftrag erteilt. Mit Hilfe eines ihm befreundeten Marquis, der zur Zeit als Vize-Präsident dem Concours hippique vorstand, sollte ich vier oder sechs Pferde zur Bespannung der neuen Staatskarosse kaufen. Diese Pferde sollten ebenfalls etwas ganz Außergewöhnliches sein, etwas, was man in Indien vorher noch nie gesehen habe.
Nun hätte ich auf Grund meiner langjährigen Praxis in Pferdesachen sehr wohl meinen eigenen Erfahrungen in der Auswahl[S. 150] von geeigneten Pferden, die dem verräterischen Klima Indiens zu widerstehen vermochten, vertrauen dürfen, um das richtige Material auch ohne Hilfe ausfindig zu machen. Seine Hoheit der Maharadscha glaubte aber, daß seine Beziehungen zu der französischen Aristokratie so intim und herzlich seien, daß er dabei in ganz freundschaftlicher und uneigennütziger Weise beraten werden würde. Ich fand aber bald heraus, daß der französische Marquis in Sachen Pferdehandel auch nicht besser war, als die verschiedenen englischen Lords, die sich mit derartigen Geschäften abgeben. In seinem Klub am Place de la Concorde gab er mir zu verstehen, daß man dort, wo Pferde in Betracht kämen, weder den eigenen Vater noch die eigene Mutter, noch die Geschwister schonen dürfe, um wieviel mehr wäre es daher selbstverständlich, daß ein so reicher Mann wie der Maharadscha daran glauben müsse! Folglich müßten wir unbedingt an dem Geschäft 50% als Provision verdienen, das heißt, diese Summe auf den wirklichen Kaufpreis aufschlagen. Da ich Befehl hatte, die von dem Maharadscha gewünschten Pferde unbedingt mit diesem Herrn zusammen zu kaufen, und keinen Grund sah, den Moralisten zu spielen, ging ich auf seinen Vorschlag ein, war aber fest entschlossen, dem Maharadscha von dem Überpreis nach meiner Rückkehr Kenntnis zu geben. Der Kauf kam denn auch zustande, und sechs gewaltige Apfelschimmel der Percheron-Rasse, die in Indien noch nie eingeführt worden war, kamen zur Verschiffung. Mit dem edlen Marquis teilte ich die Provision, die für jeden dreitausend Franken ausmachte.
Als ich, in Kapurthala angekommen, dem Maharadscha Bericht über den abgeschlossenen Pferdekauf erstattete und ihm die 3.000,— Franken, die mir in Paris ausbezahlt worden waren, auf den Tisch legte, war er aufs Tiefste entrüstet,; nicht über die Gaunerei seines Freundes, sondern, daß ich mir erlaubte, über einen so hochstehenden Herrn ihm etwas Derartiges mitzuteilen. Wahrscheinlich, äußerte er, wäre ich als Deutscher gegen die so außerordentlich ritterliche und hochstehende Nation der Franzosen gehässig[S. 151] gesinnt und habe deshalb versucht, seinen aristokratischen Freund in dieser Weise bei ihm in Mißkredit zu bringen. Seine Entrüstung ging so weit, daß er sich absolut weigerte, die fraglichen 3.000,- Franken zurückzunehmen, und ich hatte unter solchen Umständen keinen Grund, sie nicht zu behalten.
Der Galawagen, die Pferde und das Geschirr landeten wohlbehalten in Kapurthala. Da die Pferde die lange Überfahrt gut ausgehalten hatten — denn 4 bis 5 Wochen auf dem Dampfer in enge Boxen eingepfercht, verlangen eine wirkliche „Pferdenatur“ —, hatte ich schon Hoffnung, daß die Tiere sich doch vielleicht an das ungesunde indische Klima gewöhnen möchten. Jedoch war dies leider nicht der Fall; trotz aller Pflege und Vorsicht waren alle sechs nach zwei Jahren eingegangen.
Der Wagen und das Gespann indessen bereiteten beim Krönungs-Durbar in Delhi dem Maharadscha sehr große Freude. Sein Wagen wurde ganz allgemein als der schönste und eleganteste des ganzen Zuges anerkannt. Doch die Freude war nicht von langer Dauer. Der allmächtige britische Sirkar führte sich in vieler Hinsicht dem indischen Fürsten gegenüber oft recht kleinlich, ja sogar kindisch auf. Der geringste Verstoß gegen eine der bestehenden Verordnungen, oder eine Überschreitung der den Vasallenfürsten zustehenden Rechte, wird von einem engherzigen Vizekönig oft als ein Staatsverbrechen angesehen, und der „Schuldige“ wie ein dummer Junge bestraft.
Nun war in diesem Falle die Führung einer siebenzackigen Krone am Wagen, am Geschirr und auf den Uniformen der reitenden Kutscher und der hintenauf stehenden Diener ein Verstoß gegen die vizeköniglichen Vorschriften. Sie gaben Anlaß zu langwierigen Beratungen im vizeköniglichen Staatsrat. Schon nach der ersten Galaausfahrt des Maharadscha in seiner prunkvollen Staatskarosse traf tags darauf eine Mahnung vom Gouverneur der Provinz Pundschab ein, in der mitgeteilt wurde, daß ihm „nur fünf Zacken“ an der Krone zuständen und er daher in Zukunft davon abzusehen habe, den am Tage vorher benutzten[S. 152] Wagen nochmals auf britischem Gebiet in Gebrauch zu nehmen. Dschagatdschit Singh, der sich diesen Wagen besonders hatte machen lassen, um den britischen Machthabern seine unfehlbare Ergebenheit durch Glanz und Pracht bei den Krönungsfeierlichkeiten zu beweisen, war trostlos, in einer so schroffen Art und Weise abgefertigt zu werden. Selbstverständlich war es unmöglich, ohne den Wagen und das Geschirr gänzlich zu ruinieren, die Ärgernis erregenden überzähligen Zacken an den Kronen zu entfernen. So war er denn gezwungen, von seiner alten Staatskalesche Gebrauch zu machen und die neue nur in den Grenzen seines eigenen Landes zu besteigen.
Der Maharadscha von Kapurthala war einer der ersten Fürsten, der sich einen Kraftwagen kaufte. Als er dieses damals in Indien noch unbekannte Gefährt einem der alten Schule angehörenden Bruderfürsten, dem Radscha von Nabha, zeigte und ihn zu einer Spazierfahrt einlud, gab ihm dieser mit Abscheu zur Antwort, wie er, Dschagatdschit Singh, sich nur soweit vergessen könne, das Pferd, das edelste und dem Menschen treueste Tier, soweit zu verachten, um in einem solchen Scheusal von Karren in der Welt herumzufahren. Er, Nabha, ziehe es vor, seinen Palankin zu benutzen, denn wenn er irgendwo hingelangen wolle, so nehme er sich nicht nur, sondern er habe auch die dazu nötige Zeit. Niemals solle ein Radscha seine Würde durch Eile erniedrigen. Der Radscha von Nabha hatte noch nie einen Eisenbahnzug bestiegen. Wenn er Reisen auf größere Entfernung unternahm, so stand ihm die Wahl frei, auf einem Elefanten zu reiten, sich in einem Palankin tragen zu lassen oder in einem von Pferden oder Ochsen gezogenen Wagen den Weg zurückzulegen. Dieser alte Fürst war einer von denen, die nicht geneigt sind, sich um Haaresbreite der abendländischen Kultur zu nähern. Er galt deshalb auch bei den Engländern als besonders loyal und stand aus diesem Grunde in hohem Ansehen.
[S. 153]
Ein Gegenstück zu ihm war der schon in einem der vorhergehenden Kapitel erwähnte Maharadscha von Patiala. Als ich einst bei ihm zu Besuch war, frug er mich, was denn eigentlich sein Bruderfürst von Kapurthala daran finde, so oft nach Europa zu reisen? Ihm scheine es, als ob er dort nur Gelegenheit zu Abenteuern mit weißen Frauen suche. Natürlich war es meine Pflicht, das Ansehen meines Fürsten zu verteidigen, wobei ich dem Maharadscha von Patiala vorschlug, doch selbst einmal Europa aufzusuchen, wo es Anregung und Sport und allerlei Veranstaltungen gäbe, die Indien nicht biete.
„Ja,“ erwiderte mir der Maharadscha, „wie Sie ja selbst wissen, Captain, besitze ich hier in meinem Heimatlande alles, was das Herz eines Sportsmanns nur wünschen kann. Ich habe die beste Jagd der Welt, die schnellsten Rennpferde, den anerkannt vorzüglichsten Polo team und in meiner Zenana die schönsten Frauen. Warum soll ich dieses Paradies verlassen, um mich ins Ungewisse zu begeben?“
Als ich ihm auseinandersetzte, daß, ungeachtet aller dieser Vorzüge, er als Sportsmann in Europa doch mehr sehen und lernen könne, als in Indien, und daß sich ihm auf alle Fälle doch auch Neues bieten werde, was von Interesse für ihn sei, gab er mir zur Antwort:
„Sie mögen ja recht haben, aber eben deshalb, weil es mir in Europa vielleicht zu gut gefallen würde, wage ich es nicht, die Reise zu unternehmen. Es könnte mir einfallen, mich nicht mehr davon zu trennen. Ich kenne meine eigene Schwäche. Jedoch die Schmach, nicht mehr in mein Land zurückzukehren, will ich weder meiner fürstlichen Würde, noch meinen Untertanen zufügen, und deshalb unterlasse ich es, mich nach dem mir so oft geschilderten, gelobten Lande Europa zu begeben.“
Leider ist dieser vortreffliche Sportsmann, trotz seiner guten Vorsätze, nicht lange darauf an den Folgen seiner indischen Ausschweifungen gestorben.
[S. 154]
Unter den an den eingeborenen Fürstenhöfen diensttuenden Beamten sind die mit den Finanzgeschäften der Fürsten betrauten Minister wohl die einflußreichsten. Diwan Daulet Ram, wie der diese Stellung in Kapurthala bekleidende Herr hieß, hatte es verstanden, sich dem Maharadscha unentbehrlich zu machen. Schon sein Vater hatte den Posten vor ihm inne gehabt. Auch hatte die Familie besonderen Anspruch auf das Wohlwollen des Fürsten, weil der Vater Daulet Rams Dschagatdschit Singh mit zu seinem Aufstieg auf den Thron verholfen hatte. Er war es gewesen, der seinerzeit mit dem Steueraufseher, dem wirklichen Vater des Maharadscha, den Übergabevertrag abgeschlossen hatte.
Als junger Mann hatte Daulet Ram einige Jahre in England studiert und dort das juristische Examen bestanden. Neben dieser Errungenschaft der Zivilisation hatte er sich, wie üblich, alle schlechten Eigenschaften des Abendlandes angeeignet, ohne doch die mannigfaltigen Laster des Orients abzulegen. Nach dem Tode seines Vaters wurde ihm vom Maharadscha der verantwortungsreiche Posten des Diwan (Hoffinanz-Minister) übertragen, wozu ihn seine Ausbildung in England besonders befähigte. In europäischer Gesellschaft benahm er sich wie ein englischer Gentleman, was einen ganz besonders großen Eindruck auf den Maharadscha ausübte, bei dem er daher auch in sehr hoher Gunst stand. Die Richtschnur seines Tun und Denkens bestand darin, keine Rupie aus dem fürstlichen Schatz auszugeben, ohne daß ein guter Teil davon den Weg in seine eigene Tasche fand. Um diesem Prinzip ständig treu bleiben zu können, wandte er alle denkbaren Mittel an, wobei er vor keiner noch so unehrlichen Art und Weise zurückschreckte, wenn es ihm nur gelang, dieser Lebensregel gemäß zu leben.
Als der Maharadscha die erste Reise nach Europa unternahm, zeigte sich der Fürst sehr freigebig, oft sogar verschwenderisch. Da Daulet Ram während dieser Reise das Amt des Zahlmeisters innehatte, so kam er bedeutend reicher nach Indien zurück, als[S. 155] er es verlassen hatte. Unterwegs jedoch war der Maharadscha von den ihn begleitenden englischen Offizieren auf die sehr unverständlichen hohen Ausgaben aufmerksam gemacht worden, wie sie die Hotelrechnungen aufwiesen. Er beschloß infolgedessen, die ihm von Daulet Ram vorgelegten Belege, besonders die Hotelrechnungen, etwas genauer zu prüfen. Doch Daulet Ram kannte ganz genau die schwache Seite seines Herrschers und ließ sich in seinen Bereicherungsabsichten dadurch nicht beirren noch beeinträchtigen. Er wußte, daß der Fürst vom Addieren keine Ahnung hatte. Daher richtete er es mit dem Direktor oder Kassierer des Hotels, in dem die Gesellschaft für längere Zeit Aufenthalt genommen hatte, auf folgende Weise ein: außer der richtig stimmenden Rechnung wurde jedesmal noch eine zweite, zugunsten Daulet Rams falsch zusammengerechnete ausgestellt, die für den Maharadscha bestimmt war. Auf dieser letzteren wurden etwa 40-50% aufgeschlagen. Um aber ja den Verdacht des Maharadscha einzuschläfern oder abzulenken, standen unter dieser Rechnung als „Extra“ ein oder zwei Soupers mit verschiedenen Flaschen Sekt, und dies so, daß sie dem Maharadscha bei der Durchsicht besonders in die Augen fallen mußten. Der Zweck dieser „Extras“ war, daß der Fürst daran Anstoß nehmen und der großen, falsch zusammengezählten Summe keine Beachtung schenken solle. Wurde nun der Sekretär über die Extras zur Rede gestellt, so entschuldigte sich Daulet Ram damit, daß die Summe auf seine Privatrechnung hätte geschrieben werden müssen, und durch ein Versehen der Hotelleitung auf die Rechnung des Maharadscha gekommen wäre; er werde sofort die nötigen Schritte unternehmen, um die Umbuchung ausführen zu lassen. Der Maharadscha, stolz auf seine Schlauheit, dieser Unregelmäßigkeit auf die Spur gekommen zu sein, erklärte, daß er nicht mehr als die Hälfte der Ausgaben für derartige Schlemmereien seines Gefolges bezahlen werde, da er vorher nicht um Erlaubnis gefragt worden sei. Die andere Hälfte müßten die, die an dem Gelage teilgenommen hätten, aus ihrer eigenen Tasche begleichen.
[S. 156]
Da nun diese Extras sowieso nur fingiert waren, kam es Daulet Ram und seinen Genossen nicht darauf an, nur die Hälfte dieser Beträge, außer den 40-50% der Überaddition, einzustecken. Der begleitende englische Offizier sah bald ein, daß es sein Dasein in keiner Weise verschönere, wenn er sich mit der ihm übrigens gar nicht zustehenden Kontrolle der fürstlichen Ausgaben beschäftigte, und unterließ es in Zukunft, dem Maharadscha in dieser Hinsicht Vorhaltungen zu machen.
Doch nicht nur aus den Hotelrechnungen erwartete Daulet Ram einen Zufluß in seine eigene Tasche zu finden. Überhaupt sollten alle Ausgaben des Fürsten für ihn tributpflichtig gemacht werden. Nun hatte der Maharadscha die Absicht, sein neuerbautes Schloß in Mussoorie im Himalajagebirge durch die weltbekannte Firma Waring & Gillow in London in der luxuriösesten Weise mit Möbeln und Teppichen ausstatten zu lassen. Daulet Ram aber hatte schon vor der Abreise von Indien, unter Empfangnahme einer hohen Provision, einer Firma in Kalkutta versprochen, daß diese Bestellung auf seine Befürwortung hin ihr übertragen werden würde. Als der Fürst den Wunsch aussprach, mit der Londoner Firma in Verbindung zu treten, sandte Daulet Ram einen Vertrauensmann zu ihrem Direktor, um zu erfahren, wieviel man ihm, als dem Finanzminister des Maharadscha, an Provision zahlen würde, wenn es seinen Bemühungen gelänge, daß der Maharadscha die Möblierung seines indischen Schlosses der Firma Waring & Gillow in Auftrag gäbe? Dabei stellte er kaltblütig die Forderung, daß man, wenn er sich überhaupt darum bemühen solle, zunächst einmal tausend Pfund Sterling im voraus an ihn zahlen müsse.
Samuel Waring war über diese Forderung des Ministers ebenso erstaunt wie entrüstet und machte dem Vertrauensmann Daulet Rams klar, daß er wohl bereit sei, eine ansehnliche Provision zu bezahlen, nachdem seine Firma in den Besitz des Gegenwertes der gelieferten Gegenstände gekommen sei, daß er aber keinen Penny im voraus zahlen würde, um schon jetzt einen[S. 157] der Beamten des Maharadscha zu bestechen, damit seiner Firma der Auftrag des Maharadscha erteilt werde. Der Fürst habe persönlich die Pläne und Kostenanschläge geprüft und ihm die Erteilung des Auftrages in Aussicht gestellt. Er rechne daher sicher darauf, daß der Kontrakt regelrecht von ihm unterschrieben werde.
Dies paßte jedoch nicht in die Geschäftsprinzipien Daulet Rams, der für Versprechungen nichts übrig hatte. Gerissen, wie er war, und als Günstling des Maharadscha, wußte er seinen Herrn zu überreden, den Vertrag nicht zu unterschreiben. Er stellte ihm vor, daß die Möbel nicht eher bezahlt werden dürften, als bis sie fix und fertig im Schlosse aufgestellt wären.
Auf diese Forderung konnte selbstverständlich eine erstklassige europäische Firma nicht eingehen, weil es keinen Klageweg gegenüber einem indischen Fürsten gibt. Die anglo-indische Regierung ist der Ansicht, daß, wer immer sich auf Verträge mit indischen Fürsten einläßt, dies auf sein eigenes Risiko tut, denn sie unterstehen in dieser Hinsicht nicht dem englischen Gesetz.
Für die Firma Waring & Gillow war das Nichtzustandekommen des Vertrags ein ziemlicher Schlag, denn durch das Möblieren des Schlosses des Maharadscha von Kapurthala in Mussoorie hatte sie gehofft, eine gute Kundschaft in Indien zu erwerben. Diwan Daulet Ram aber genoß die Erfolge seiner Lebensregel nicht allzulange, denn er starb selbst für indische Verhältnisse als noch recht junger Mann.
Im Laufe seiner Krankheit kam, trotz seiner abendländischen Erziehung, wieder der wahre indische Charakter zum Vorschein. Der Maharadscha ließ ihn, um ihm die beste Pflege zu verschaffen, durch einen anerkannt tüchtigen englischen Arzt behandeln. Ohne dessen Wissen jedoch wurde von den Familienangehörigen ein indischer Hakim (Eingeborenen-Doktor) herangezogen, der die Verordnungen des weißen Arztes durch seine Pfuschereien zunichte machte. Dem englischen Arzt war die Erfolglosigkeit seiner Behandlung unbegreiflich, doch er hatte immer noch Hoffnung, den Kranken zu retten. Kurz nach seinem letzten Besuch aber erfuhr[S. 158] er, daß der Patient gestorben sei. Als ich ihm mitteilte, daß Daulet Ram auf den Rat des Hakim als einziges Mittel, das ihn wiederherzustellen vermöge, einen Liter Ganges-Wasser getrunken habe, wurde ihm jedoch die Ursache der Erfolglosigkeit seiner Bemühungen verständlich.
Vielleicht daß die lieben Verwandten mit Rücksicht auf die Erbschaft etwas Gift unter das Gangeswasser gemischt hatten, um den Kranken von seinen Schmerzen zu befreien! Immerhin, ein Liter des schmutzigen Gangeswassers sollte genügen, den gesündesten und robustesten Menschen von seinem irdischen Leben zu erlösen. Festgestellt konnte nichts werden, da schon vier Stunden nach dem Tode der Körper verbrannt war.
Ebenso wie Dschagatdschit Singh über die Unehrlichkeit des oben erwähnten Duma Mal sich keiner Illusion hingegeben hatte, so wußte er auch, daß Diwan Daulet Ram stets zuerst für seine eigene Tasche besorgt gewesen war. Auf die Dauer fand er es aber etwas kostspielig, auch in Europa überall mit „fürstlichen“ Trinkgeldern standesgemäß auftreten zu müssen, wie seine indischen Beamten sie ihm in so virtuoser Weise abzunehmen wußten.
Er beschloß daher, nach einem billigeren Mittel zu suchen, das denselben Zweck zu erfüllen geeignet sei. So kam er auf den Gedanken, den Kapurthala-Hausorden zu stiften. Wenn man eine größere Menge davon einer leistungsfähigen Fabrik zur Anfertigung in Auftrag gab, mußte dies nicht unbedeutende Ersparnisse bringen. Und die Ehrung des Empfängers, von der erlauchten Hand eines leibhaftigen indischen Herrschers die Auszeichnung angeheftet oder um den Hals gehängt zu erhalten, war in Geldwerten überhaupt nicht auszudrücken.
Es wurde also eine Stufenfolge des Kapurthala-Hausordens in vier Klassen geschaffen:
Erstens das Großkreuz, für den Maharadscha und seine Nachfolger oder besonders erhabene Mitglieder seiner Familie;
[S. 159]
dann das Offizierskreuz I. Klasse, für leibhaftige Prinzen und ähnliche hohe Standespersonen;
weiter dasselbe, aber II. Klasse, für höhere Beamte und Offiziere, und schließlich:
das Ritterkreuz, für Hoflieferanten, Hoteldirektoren, Oberkellner, Lakaien und für die Soldaten des Kapurthala-Regiments.
Und der Gedanke des Fürsten war wirklich ausgezeichnet. So lächerlich die menschliche Natur auch oft erscheint, sie bleibt sich überall gleich. Sobald bekannt wurde, daß Seine Hoheit der Maharadscha Orden verteile, nahm die Gewissenhaftigkeit in der Bedienung, von manchem Hoteldirektor an bis zum Liftjungen, zusehends zu. In ihren Augen war erst jetzt der Maharadscha ein wirklicher Fürst. Nach vier oder sechs Wochen Aufenthalt zog Dschagatdschit Singh jetzt eine Handvoll von Ritterkreuzen aus der Tasche, statt der früher notwendigen teuren Brillantnadeln, goldenen Uhren und Zigarettendosen. Es kam dies ganz bedeutend billiger und hatte außerdem noch den erwähnten Vorteil besserer Bedienung.
Nur den indischen Staatsbeamten in Kapurthala war der Orden weniger angenehm. Sie zogen solide, recht massive Geschenke bei weitem dem allerdings höchst dekorativ wirkenden Bande des Kapurthala-Hausordens, in den Staatsfarben blau-weiß, vor. Doch gerade für indische Verhältnisse schien dem Fürsten die Ordensauszeichnung ganz besonders praktisch.
Geschenke in Indien zu geben, ist ein recht undankbares Unternehmen. Wenn einem der Staatsminister ein Pferd als Zeichen der fürstlichen Huld und Anerkennung übersandt wird[11], so beeilt sich der Empfänger, seinen Dankesbesuch abzustatten und dabei dann recht klar und deutlich darauf hinzuweisen, daß zunächst ein solches Tier die unangenehme Eigenschaft habe, zu fressen, ja daß es ohne die entsprechende Nahrung überhaupt nicht zu viel nütze sei. Daher müsse er doch den Maharadscha bitten,[S. 160] auch seinen Gehalt entsprechend zu erhöhen, damit der Empfänger für den Unterhalt des herrlichen Tieres sorgen könne.
War nun dieses Anliegen zur Zufriedenheit des Beschenkten erledigt, wobei natürlich die Gehaltsaufbesserung ausreichend sein mußte, um wenigstens zehn Pferde bis zur Erreichung des Schlachtgewichtes eines Ochsen füttern zu können, so wurde die Frage aufgeworfen, wie es wohl möglich sei, das edle Roß ohne Sattel und Zaumzeug zu reiten? Der Empfänger sei der Annahme, daß der Maharadscha Wert darauf lege, durch die Vorführung des geschenkten Pferdes in den Straßen Kapurthalas die Bevölkerung seiner Haupt- und Residenzstadt von seiner Großmut in der Belohnung geleisteter Dienste zu überzeugen.
Doch nicht nur geschenkte Pferde, die übrigens meistens nur noch zur Verarbeitung als Katzenfutter zu gebrauchen waren — die Auswahl der zu verschenkenden Pferde war glücklicherweise mir überlassen —, lösten so eine Bitte nach der anderen aus. So schenkte eines Tages Dschagatdschit Singh seinem Finanzminister Sirdar Assis Buksch eine wirklich schöne goldene Uhr. Der Minister nahm sie schweigend an und wog sie nachdenklich in der Hand, bis dies Gebaren selbst der unerschütterlichen Ruhe des Maharadscha zu viel wurde, und er frug, ob das Geschenk dem Minister keine Freude bereite.
„Husur![12] Das ist es nicht“, versicherte der Sirdar, dem Fürsten als Zeichen seiner Unterwürfigkeit den Turban in den Schoß legend. Er sei voller Freude über das so schöne Geschenk und besonders darüber, daß der Maharadscha seine Verdienste um das Wohl des Staates in so großmütiger Weise anzuerkennen geruhe. Er sei nur soeben in seinen Gedanken mit der Frage beschäftigt gewesen, einen Weg zu finden, wie er diese herrliche und kostbare Uhr nun auch wohl tragen könne. Soviel ihm bekannt wäre, würden diese Gegenstände an einer Kette getragen, und ..., nun, er, der Sirdar, habe zwar keine, und er wisse auch nicht, wie er[S. 161] sich eine solche beschaffen solle, arm und bescheiden wie er sei. Dies wäre der Grund seiner unhöflichen Befangenheit und seines Nachdenkens gewesen.
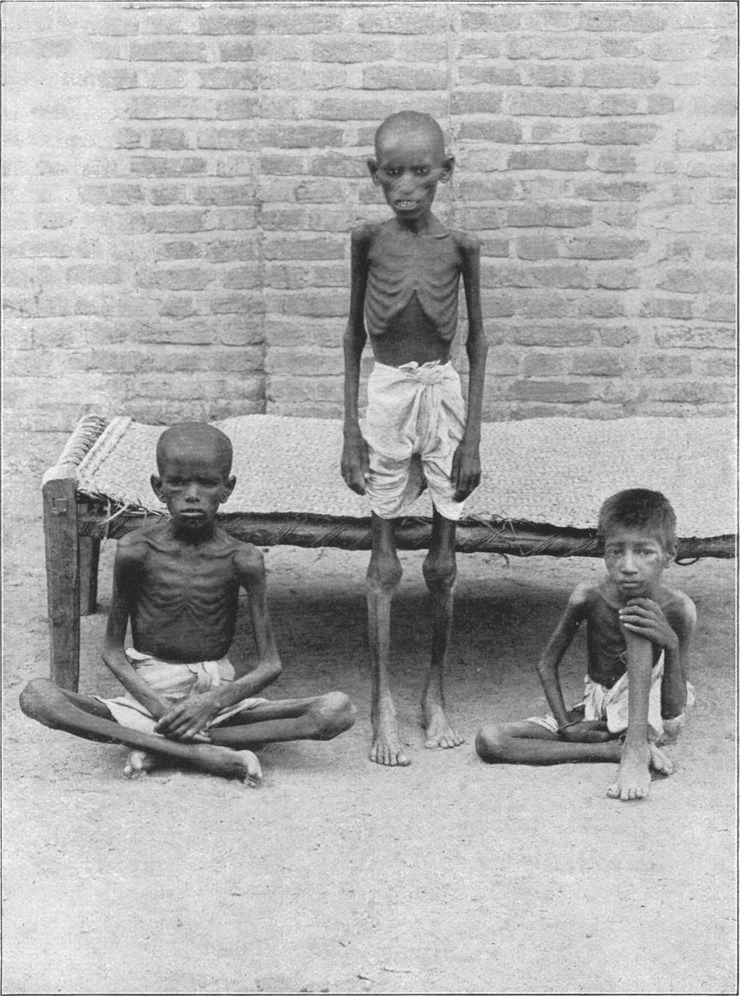

Der Finanzminister war viel zu wichtig, als daß Dschagatdschit Singh einen Mißton hätte aufkommen lassen können. Daher folgte der Uhr schnell und geräuschlos die goldene Kette.
All dies, so dachte der Maharadscha, sollte nun aufhören und für immer vorbei sein. Der Kapurthala-Hausorden würde viel billiger kommen, besonders da ja drei verleihbare Klassen zur Verfügung standen, die Verleihung also in gesteigerter Form wiederholt werden konnte.
Um aber seinen indischen Untertanen, die, wie gesagt, der Neuerung etwas skeptisch, um nicht zu sagen ablehnend gegenüberstanden, die Wertschätzung des Ordens selbst bei den höchststehenden Europäern recht deutlich vor Augen zu führen, benutzte der Fürst die erste Gelegenheit, die sich ihm bot, die Verleihung des Ordens an einen vornehmen Franzosen mit großem Zeremoniell vorzunehmen.
Eines Tages trifft in Kapurthala der dem Maharadscha gut bekannte französische Prinz de Broglie mit der Prinzessin und Gefolge ein. Vor diesen hochgeehrten Gästen wird nun ein gewaltiger „Durbar“ (ein öffentlicher Empfang) in dem großen Durbarsaale des Regierungsgebäudes abgehalten. Alle Beamten, Offiziere, Soldaten und was sonst noch irgendwelchen Anspruch auf Beachtung erheben konnte, wurden aufgeboten, und die französischen Gäste sollten bei dieser Gelegenheit mit dem Hausorden von Kapurthala geschmückt werden, was ganz ohne Zweifel seine Rückwirkung auf die Wertschätzung des Ordens selbst durch die Untertanen des Maharadscha nicht verfehlen konnte.
Nach Abspielen der Kapurthala-National-Hymne durch die Kapelle des Kapurthala-Regimentes bat der erste Minister den Prinzen Broglie und seine Freunde, dem Maharadscha, der inmitten der Großen seines Reiches in Pomp und Würde thronte, näherzutreten, und der Fürst hing einem jeden der Gäste die ihm[S. 162] zustehende Klasse des Hausordens am blau-weißen Bande um den Hals.
Mit tiefen Verbeugungen und unter Bezeugung ihrer vollendeten Ehrerbietung nahmen die Franzosen die Auszeichnung an und reisten kurz darauf stolz und befriedigt wieder ab und in ihr Land zurück.
Nun war aber Prinz de Broglie auch Inhaber der Ehrenlegion. Bei irgendeinem Feste, das der Präsident der französischen Republik im Elysée gab, prangte der Kapurthala-Hausorden neben dem Großkreuz der Ehrenlegion auf seiner Brust und verfehlte nicht, es durch die Pracht seiner Brillanten bei weitem zu überstrahlen. Die kostbare Auszeichnung machte Aufsehen, und zum Schluß schien es selbst dem Ordensmeister — neugierig, wie alle Ordensmeister sind — notwendig, sich nach dem Lande zu erkundigen, das diesen, in keinem offiziellen Ordensverzeichnis der Welt aufgeführten, gewaltigen Stern an dem unerhört breiten, wuchtigen blau-weißen Bande verlieh.
Stolz auf seine Reisen in exotischen Ländern, gab der Prinz gern die gewünschte Aufklärung, daß der Orden ihm, in Bewunderung der Leistungen eines Mitgliedes der hohen Aristokratie der „grande Nation“, in ganz besonderer, nur für ihn angeordneter, großer Audienz von dem mächtigen Herrscher des großen indischen Reiches Kapurthala überreicht worden sei.
Der Ordensmeister, das Ordenskabinett, der Minister des Äußeren selbst und das Pariser Auswärtige Amt hielten eine Bereicherung ihrer Kenntnisse in dieser Angelegenheit für wünschenswert. Von dem Drang nach Aufklärung beseelt, wagten sie es, trotz der unendlichen politischen Tragweite der Frage, den englischen Botschafter zu bemühen. Da diesem aber die Tatsache der Existenz des Kapurthala-Hausordens ebenso neu war, gab er die Anfrage nach London weiter, wo sie dem Staatssekretär für indische Angelegenheiten vorgelegt wurde, der sich seinerseits an den Vizekönig von Indien mit dem Ersuchen um Aufklärung wandte. Der Vizekönig von Indien, Lord Curzon, sowieso kein Freund[S. 163] des Maharadscha, beauftragte den Gouverneur des Pundschab, Klarheit in die Sache zu bringen.
Nachdem nun die Wellenschläge dieser hochwichtigen diplomatischen Aktion sich bis an den Felsen Kapurthala fortgepflanzt hatten, begannen sie sich zu überstürzen und den armen Dschagatdschit Singh mit dem Tosen ihrer Brandung zu betäuben. Es wurde ihm auf das dringlichste nahegelegt, Einfälle, wie den vorliegenden strahlenden Ordensstern, die so komplizierte und für die überlasteten Behörden so arbeitsreiche Folgen nach sich ziehen könnten, in Zukunft unter allen Umständen zu unterlassen, besonders wenn sie, wie der in Frage stehende, nur zu geeignet wären, das Ansehen seiner Bruderfürsten und das des „Sirkar“ in so gefährlicher Weise zu untergraben.
Nun hatte Dschagatdschit Singh es vorgezogen, keiner Menschenseele, auch mir nicht, etwas von diesen peinlichen Folgen seines Sparsamkeits-Einfalles mitzuteilen, bis eines Tages der Prinz Louis von Bourbon-Braganza mit seinem Freunde, dem Prinzen de la Tour d’Auvergne, in Kapurthala eintraf. Auch sie hatten von dem sagenhaften Glanz des Kapurthala-Hausordens gehört, doch da sie die Reise nach Indien über Land gemacht hatten, waren ihnen die von ihm ausgelösten diplomatischen Verwicklungen nicht bekannt geworden.
Während der Jagd fragte mich nun der Prinz von Bourbon, ob ich dem Maharadscha nicht nahelegen könnte, auch ihn in gleicher Weise wie den Prinzen Broglie auszuzeichnen.
„Nichts leichter als das“, antwortete ich ihm leichten Herzens. „Sie können bestimmt darauf rechnen, ebenso wie Ihr Freund, Kapurthala im Glanze seines Sternes zu verlassen.“
Als ich aber Dschagatdschit Singh das Anliegen der beiden Franzosen vortrug und erwartete, daß er mit Freude die Gelegenheit ergreifen werde, die hohe Wertschätzung seiner Ordensschöpfung von neuem in das helle Licht eines feierlichen Durbar zu setzen, erfuhr ich, daß der Stern von Kapurthala erloschen sei und wie diese Katastrophe sich zugetragen habe.
[S. 164]
An mir war es nun, den hohen Herren aus Frankreich die Ablehnung ihres Wunsches mit viel Takt und noch mehr Lügen beizubringen. Zum Trost erhielt jeder von ihnen einen sehr wertvollen Kaschmirschal, doch der Maharadscha hatte noch lange Zeit ein schmerzliches Lächeln, wenn der Hausorden von Kapurthala am blau-weißen Bande in vier Klassen erwähnt wurde.
Die Mißstimmung Dschagatdschit Singhs, den ihm von so glanzvoller Seite, wie dem Prinzen von Bourbon, nahegelegten Wunsch haben abschlagen zu müssen, hatte aber einen tieferen, mehr indischen Grund als den Schmerz über den untergegangenen Stern.
Es ist in Indien uralte Sitte, daß der Gastgeber alles das, was ein hoher und geehrter Gast bei ihm bewundert, ohne weiteres ihm als Geschenk überreicht, gerade so wie der Maharadscha von Patiala dies mir gegenüber mit meinem Rennpferde „Foxy“ getan hatte. Für den Fürsten von Patiala war dies Geschenk damals eine Kleinigkeit gewesen, und er hatte ohne irgendeinen bedauernden Gedanken das übliche: „Dumara ke bas hai!“ — Es sei dein — gesprochen[13].
Anders aber verhält es sich, wenn der Gast irgendeinen besonders wertvollen Gegenstand oder irgend etwas, an dem der Gastgeber mit besonderer Liebe hängt, mit seiner Bewunderung beehrt und dies ausspricht. Auch dann muß der alten Sitte Genüge getan und mit freundlicher Würde selbst die teuerste und liebste Sache dem Bewunderer ausgehändigt werden.
Hierin liegt auch einer der Gründe, weshalb die indischen Fürsten sich gegenseitig nicht so oft besuchen. Binnen kurzem hätte einer den anderen ruiniert. Da nun aber diese Besuche nicht zu umgehen sind, erfordert es im Hinblick auf diese Sitte der indische Anstand, niemals irgend etwas, das dem Gastgeber[S. 165] gehört, zu loben oder, sei es auch noch so schön, zu bewundern. Bei einem Besuche, den ich einst dem Nawab von Bahawalpur abstattete, erzählte er mir, hieran anschließend, ein Erlebnis vornehmlich zum Beweis, wie minderwertig doch die englische Erziehung sei und wie sie auch geborene Inder dazu verleite, die vornehmen Sitten ihrer Väter zu vergessen.
Bahawalpur liegt an der Grenze Belutschistans in Nordwest-Indien und stößt im Osten an den Pundschab. Einer der im südöstlichen Teile der Provinz regierenden fünf Sikhfürsten, der Radscha von Farikot, hatte seinen Sohn Tika Bolan Singh auf der vornehmen englischen Schule in Aligarh erziehen lassen. Nach Beendigung der Studien sandte er ihn nun zu den Nachbarfürsten auf Besuch, damit alle sein Wissen, seine Bildung und sein gutes Benehmen bewundern sollten.
Auf dieser Rundreise kam der junge Thronfolger von Farikot auch nach Bahawalpur, und der Nawab, ein mohamedanischer Fürst, hielt ihm zu Ehren ein großes Durbar ab, wobei er, um den Eindruck zu erhöhen, sich in aller Pracht seiner Staatsgewänder und im Schmucke seiner schönsten Juwelen zeigte. Der neben ihm sitzende Tika Bolan Singh machte dabei in Gegenwart aller Gäste eine bewundernde Bemerkung über den prachtvollen Rubinring, den Nawab am Finger trug.
Obgleich dieser Ring dem Fürsten ganz besonders teuer war, war ihm doch die Wahrung der alten indischen Sitten noch teurer. Ohne eine Miene zu verziehen, nahm er den Ring vom Finger und überreichte ihn dem jungen Hinduprinzen: „Ab ke bas hai!“ — Er sei dein —, der ihn gelassen annahm und sich ansteckte.
Die Taktlosigkeit des jungen Mannes erzürnte den Nawab fast noch mehr, als der Verlust des Ringes selbst. Doch er, als alter mohamedanischer Fürst, wäre eher gestorben, als sich vor einem ungläubigen Hindu eine Blöße zu geben. Jedoch er beschloß, dem so englisch erzogenen jungen Prinzen eine Lehre zu geben und ihm den Wert der überlieferten indischen Sitten recht eindringlich vor Augen zu führen.
[S. 166]
Als der Radscha von Farikot nicht lange darauf starb und Tika Bolan Singh seinem Vater auf den Thron des Sikh-Fürstentums folgte, erhielt auch der Nawab von Bahawalpur eine Einladung zu den Festlichkeiten des Regierungsantrittes. Damit bot sich ihm die ersehnte Gelegenheit, seinen Vorsatz auszuführen, und er nahm die Einladung an.
Zunächst erschien er in Farikot mit einem riesigen Troß. Eine Kamelleibwache und ein Bataillon Sipahi-Soldaten begleiteten ihn. Der junge Maharadscha Bolan Singh überschlug die Ausgaben, die der Unterhalt dieser Gäste ihm verursachen würde, und fühlte sich etwas bedrückt. Doch seinem hohen Gast mußte er mit Freundlichkeit und Gastlichkeit begegnen. Er verzog also ebenfalls keine Miene und verpflegte den Nawab und dessen zahlloses Gefolge auf das beste.
Unter den Festvorstellungen, die zu Ehren der eingeladenen Gäste angesetzt waren, war auch eine große Treibjagd auf Antilopen vorgesehen. Dabei konnte es nicht ausbleiben, daß zusammen mit den Antilopen ganze Herden von „Nilgaus“, die eine Zwischenstufe zwischen Hirsch und Kuh vorstellen, in den Kreis der Jäger getrieben wurden. Da nun die Nilgaus der Kuh verwandt ist, wird sie von den Hindu ebenso heilig wie das Rind gehalten. Sie tritt daher in den Nordwest-Provinzen Indiens äußerst zahlreich auf. Der Nawab von Bahawalpur aber war ein mohamedanischer Fürst, dem weder Kuh noch Nilgaus heilig scheinen. Anstatt Antilopen zu schießen, schoß er nun nur Nilgaus!
Der Radscha Bolan Singh, der neben ihm auf einem Elefanten ritt, machte ihm Vorstellungen. Doch der Nawab sagte trocken, daß es in seinem Lande Sitte sei, diese unnützen, den Ackerbau verwüstenden Tiere zu vertilgen. Auch liebe sein Gefolge das sehr wohlschmeckende Fleisch. Er fuhr also ruhig fort, die Strecke um eine immer wachsende Zahl der heiligen Nilgaus zu bereichern, die seine Leute mit großem Geschrei sammelten, um sich zum Entsetzen der Hindubewohner von Farikot den Magen mit ihrem heiligen Fleisch zu füllen.
[S. 167]
Doch diese kleine Lehre genügte dem Nawab von Bahawalpur noch nicht. Der Rubin, den er dem jungen Radscha hatte geben müssen, war ihm zu teuer gewesen, und der Verstoß gegen die indischen Sitten, der ihm den Ring gekostet hatte, war durch eine Verletzung der Hindugefühle in Farikot noch nicht wettgemacht.
Daher fing der Nawab an, von seiner Seite zu loben. Er begann mit dem Elefanten, den er ritt. Er war der beste des Radscha. „Ab ke bas hai!“ — er ist dein — konnte dieser nur sagen. Bei dem Besuche des Marstalls wußte der Nawab sehr wohl die besten Pferde zu entdecken — und zu bewundern: „Ab ke bas hai!“ mußte der Maharadscha von Farikot antworten. Doch er hütete sich wohl, dem Gast die Schatzkammer zu zeigen und ließ sich vor dem Nawab nicht im Schmucke irgendwelcher Juwelen sehen.
Er hatte das sonderbare Verhalten seines Gastes wohl verstanden und hoffte nur, er würde kein Stück der so leicht erworbenen Tiere mitnehmen.
Doch der Nawab vergaß weder den Elefanten noch eins der Pferde, die seine Bewunderung erregt hatten. Alle wurden von den Leuten aus Bahawalpur sorgsam mit nach Hause geführt, bis ihr Herr seinen Besuch am Hofe zu Farikot genügend eindrucksvoll gestaltet zu haben glaubte, um dem jungen Radscha vor Augen zu führen, daß auch die beste englische Erziehung doch nicht genüge, sich mit Anstand unter Indern zu bewegen.
Immerhin ist diese Art der Erwerbung von Gegenständen nicht die unter indischen Fürsten allgemein übliche. Im Gegenteil, sie lieben es, zu kaufen, und wenn sie kaufen, kaufen sie großzügig. So erschien einmal der schon verschiedentlich erwähnte Maharadscha von Patiala in dem großen Glasgeschäft von Osler & Co. in Kalkutta. Es ist Brauch, daß bei so hohem Besuch die Verkaufsräume von allen anderen Besuchern geräumt werden und[S. 168] während der Zeit der Anwesenheit des indischen Fürsten für gewöhnliche Menschen gesperrt bleiben.
Der Maharadscha ging durch die großen Räumlichkeiten und fand viel Gefallen an den meisten Dingen. Besonders schön erschienen ihm die großen Kristall-Kronleuchter, die überhaupt in Indien hoch in Ansehen stehen. Nicht nur haben sie als Beleuchtungskörper einen gewissen Wert, so fraglich dieser auch vom Zweckmäßigkeitsstandpunkt aus eingeschätzt werden mag, sondern sie wirken vor allen Dingen höchst eindrucksvoll. Daher können auch gar nicht genug dieser klingelnden Strahlenbrecher an der Zimmerdecke aufgehängt werden.
Nachdem der Maharadscha mit Interesse alles, was es zu sehen gab, besichtigt hatte, beschloß er einzukaufen. Er wendete sich also an den ihn führenden Inhaber des Hauses und fragte, wieviel er wohl für die Hälfte aller vorhandenen Gegenstände fordere.
Schnell wurden die Bücher eingesehen, Preise ausgezogen, Summen zusammengezählt und endlich der Preis für eine Hälfte der vorhandenen Waren genannt. Der Maharadscha, der annahm, daß in dieser einen Hälfte wahrscheinlich alle die Dinge eingeschlossen wären, die weniger Wert hätten, glaubte äußerst geschickt und klug zu handeln, indem er antwortete:
„Nun gut! Ich biete Ihnen die gleiche Summe, aber für die andere Hälfte ihrer Warenbestände, unter der Bedingung, daß die Sachen sofort an meine Residenz in Patiala gesandt werden.“
Da es sich um etwa zwei Lakh Rupien oder rund dreimalhunderttausend Mark (Gold) handelte, nahm die Firma diesen Vorschlag sofort an.
Kurz nach dem einige Jahre später erfolgten Tode des Maharadscha habe ich in Patiala die Kisten dieser Sendung noch stehen sehen. Sie waren nicht einmal geöffnet, und die ganze Bestellung kam in die Konkursmasse des starkverschuldeten Herrschers.
Warum hatte der Maharadscha nun all diese, zum überwiegenden[S. 169] Teil für ihn ganz unbrauchbaren Dinge gekauft? Einfach aus der naiven Annahme, daß allein auf diesem Weg er es für alle anderen Sterblichen verhindern könne, in den Besitz der Gegenstände zu kommen. Denn selbstverständlich muß ein Maharadscha in allen Dingen turmhoch über den anderen Menschen stehen.
In ähnlicher Weise verfuhr der damals ungeheuer reiche Nisam von Haiderabad. Als ich im Jahr 1893 zum Training einiger meiner Rennpferde in Kalkutta war, begegnete mir in der Nähe der Bahn Seine Hoheit der Nisam, begleitet von seinem Adjutanten Assur ul Mulk und gefolgt von der ihm zustehenden großen Eskorte.
Bei dem Vorbeireiten hatte er mich besonders scharf angesehen, und ich bemerkte, wie er kurz darauf haltmachte. Ich wandte mich um und sah seinen Adjutanten auf mich zugesprengt kommen. Schon durchzuckte mich der Gedanke, daß das Pferd, das ich ritt, aus irgendeinem Grunde dem Nisam gefallen habe, und ich überlegte schnell, welche fabelhafte Summe ich für das natürlich in jeder Hinsicht vollendete und wertvolle Tier verlangen sollte, als der Adjutant sein Pferd neben mir parierte und mich außerordentlich höflich bat, ihn bis zum Nisam zu begleiten.
Ich verdoppelte in Gedanken sofort den Kaufpreis, den ich dem Herrscher von Haiderabad für mein kostbares Tier abverlangen würde und folgte Assur ul Mulk, den ich kannte. Der Nisam ritt einen prachtvollen Araberhengst und begrüßte mich äußerst freundlich, erkundigte sich nach den Fortschritten meiner Pferde und fragte plötzlich:
„Und bei welchem Schneider lassen Sie arbeiten?“
Zuerst sah ich den Fürsten ziemlich erstaunt an, bis er fortfuhr:
„Ich meine den, der Reitbeinkleider anfertigt, wie Sie sie tragen!“
Damit wurde mir der Zusammenhang klar. Mit dem Pferdekauf war es nichts! Ich trug damals Reitbeinkleider eigener Erfindung, eine Kreuzung zwischen englischen „breeches“ und[S. 170] den Reithosen der Radschputsen, von ihnen „Pydschama“ genannt, die über dem Knie englisch weit, unter ihm indisch-radschputsisch eng an der Wade anliegend bis zum Fuße reichen und das Tragen von Reitstiefeln oder Gamaschen, eine Qual in der feuchten Hitze Kalkuttas, überflüssig machen.
Ich nannte dem Nisam die Firma und erwähnte, daß es nur einen einzigen Schneider in der Welt gäbe, der diese Beinkleider zu bauen verstünde. Nun wird in Indien ganz sinnloser Wert auf Bekleidung, wie überall im Orient, gelegt, und auch unter den indischen Beamten und Offizieren ist man ganz besonders wählerisch in der Mode, so daß gewisse Schneiderfirmen gradezu Künstlerruhm genießen.
Huldvollst entließ mich der Nisam, und etwas enttäuscht und im Innern über die Unverschämtheit, mich wegen einer solchen Lappalie aufgehalten zu haben, entrüstet, ritt ich weiter, als ich wiederum Pferdehufe hinter mir näherkommen hörte. Assur ul Mulk erschien von neuem an meiner Seite, um mich zu bitten, doch meinen Schneider zu benachrichtigen, daß der Nisam am folgenden Morgen um zehn Uhr bei ihm vorsprechen würde, um Reitbeinkleider zu bestellen.
Auch würde der Nisam mir bei dieser Gelegenheit nochmals die hohe Ehre seiner erhabenen Gegenwart gestatten, um der Firma die nötigen Anweisungen zu geben.
Das war allerdings besser als Pferdehandel. Ich ritt sofort zu dem Künstler, der der Herstellung meiner Reit-Unaussprechlichen seine Geschicklichkeit und Erfahrung zuzuwenden geruhte, und teilte ihm mit, welchen Erfolg meine Kreuzung zwischen „breeches“ und „pydschama“ heraufbeschworen habe. Der Direktor der Schneiderfirma traute kaum seinen Ohren.
Als er endlich begriffen hatte, daß ich ihm keine Märchen erzählte, versprach er mir, mich bis zu meinem Sarge mit allen Kleidungsstücken zu versehen, die ich nur wünschen möge, wenn der Nisam tatsächlich das Licht seiner Gegenwart und seines Goldes in den Räumen seines Geschäftes leuchten lassen sollte.[S. 171] Denn wenn einer dieser indischen Halbgötter kauft, so ist ein gutes Geschäft sicher. Auch strömt dann, und je höher der Halbgott in der indischen Eitelkeitsskala steht, desto stärker auch der ganze Schwarm aller anderen Maharadschas, Radschas und sonstigen Betitelten, sowie aller derer, die ihnen nachzueifern als das höchste Ziel ihrer Existenz halten, in den so begünstigten Laden und kauft, kauft, kauft.
Ich ermahnte den Geschäftsinhaber noch, während der Anwesenheit des Nisam keinen Sterblichen außer mir und seinen Angestellten das Betreten des Geschäftes zu gestatten.
Punkt zehn Uhr am folgenden Morgen fuhr Seine Hoheit der Nisam von Haiderabad vor und betrat den Geschäftsraum. Als er mich zu bemerken geruhte, sagte er nur:
„Ich wünsche Reitbeinkleider, von dem gleichen Schnitt, wie dieser Herr sie trägt.“
Nun wurden ihm Stoffe zur Auswahl vorgelegt. Doch er wehrte kurz und herrisch ab.
„Machen Sie mir Reitbeinkleider von allen vorhandenen Stoffen, die sich dazu eignen.“
Niemand durfte sich rühmen können, einen Stoff zu tragen, den er, der Nisam, nicht auch besäße. Alle Stoffe überhaupt aufzukaufen, wie er ganz sicher am liebsten getan hätte, war nun leider doch nicht möglich!
Also wurden ihm nicht weniger als zweihundertfünfundachtzig Paar Reitbeinkleider geliefert! Natürlich war es undenkbar, den Nisam zu ersuchen, sich Maß nehmen zu lassen. Ein Kammerdiener mußte bestochen werden, der Firma ein entsprechendes Kleidungsstück des Herrschers zu verschaffen.
Überhaupt war dieser Nisam von Haiderabad wohl einer der sonderbarsten unter den vielen sonderbaren Fürsten Indiens, wie er ja der angesehenste und im Range am höchsten stehende ist.
Im Jahre 1894 kam der schon in Verbindung mit Rudyard[S. 172] Kiplings Roman „Kim“ und Marion Crawfords Heldenschauermär „Mister Isaacs“ erwähnte Armenier Jakob, der in Indien unter dem Namen „Jacob of Simla“ bekannt war, nach Haiderabad.
Durch Vermittlung des vertrauten Kammerdieners „Abid“, der ebenfalls ein Armenier war, hatte sich Jakob in die Gunst des Nisam von Haiderabad einzuschmeicheln verstanden. Der Fürst, der heute schon lange tot ist, war stets etwas tiefsinnig und in manchen Zügen dem König Ludwig von Bayern vergleichbar. Sein Stolz auf seine Stellung war grenzenlos. Er dünkte sich in jeder Weise über alle anderen Menschen erhaben. Um von ihm in Audienz empfangen zu werden, mußte selbst sein erster Minister die Fürsprache des Kammerdieners Abids einholen, so groß war Abids Einfluß auf seinen Herrn. Er wich aber auch nicht von seiner Seite, und wie er mir selbst erzählt hat, konnte es keine schwierigere Aufgabe geben, als den Nisam bei Laune zu erhalten. Zuweilen mußte er eine halbe Stunde unbeweglich vor seinem Herrn stehen, ehe er ihm das Gewünschte, einen Becher Wasser oder dergleichen geben konnte.
Der Armenier Jakob behauptete nun, mit magischen Kräften begabt zu sein. Beschlagen in Astrologie und ähnlichen Dingen, die er in seiner Jugend, als Sklave in Konstantinopel, erlernt haben wollte, fand er in dem Nisam einen gutwilligen Zuhörer.
Ein englisches Syndikat hatte damals einen sehr wertvollen Diamanten, für den es so leicht keinen Käufer finden konnte, erworben, und es gelang Jakob, den Auftrag zu erhalten, diesen kostbaren Stein, den „Imperial Diamant“, dem Nisam anzubieten.
Wenn ich mich recht entsinne, belief sich der Preis auf fünfzig Lakh, das sind ungefähr acht Millionen Mark (Gold). Der Nisam willigte ohne Feilschen ein, den Edelstein zu diesem Preise zu erwerben.
Im Vertrauen auf den ihm versprochenen großen Gewinn trieb nun Jakob großen Aufwand. Man hätte glauben können, er sei der größte Nabob des indischen Kaiserreichs. Dies mußte auffallen,[S. 173] zumal er die von ihm gegebenen festlichen Gelage im Hotel „Esplanade“ in Bombay, wo ich ihn öfter traf, nicht im Verborgenen abhielt. Der Besitzer dieses Hotels hieß Sirdar Abdul Hugh und war im Hauptberuf — Minister des Innern im Staate von Haiderabad.
Jakob prahlte viel mit seiner Freundschaft und seinem Einfluß auf den allmächtigen Nisam und pflegte zu sagen, daß, wenn erst der Kauf perfekt sei, er einen Dampfer chartern und seine guten Freunde zu einer Vergnügungsreise nach Europa einladen werde.
All dies kam natürlich auch zu den Ohren der anglo-indischen Regierung und erregte ihre Aufmerksamkeit, bis dann zu guter Letzt auch noch die Verwaltung des Nisam bei der Bengal-Bank um einen riesigen Vorschuß einkam, was der Regierung ebenfalls nicht verborgen blieb.
Damals standen die Finanzen des Staates von Haiderabad sehr schlecht, weil das Land und besonders die ertragsreichste Provinz, Behar, von einer schweren Hungersnot heimgesucht worden war.
Der Resident am Hofe des Nisam, Sir William Clichele Plowden, setzte im Einverständnis mit dem Vizekönig, der traurigen Lage des Landes wegen, alle Hebel in Bewegung, den Kauf des „Imperial Diamant“ rückgängig zu machen. Um den Nisam, der ungeheuer viel auf seine Würde als allmächtiger Herrscher hielt, nicht zu einem Rücktritt von dem Kauf zu zwingen, was für ihn beleidigend gewesen wäre, suchte der Resident ihm beizubringen, daß er einem Schwindel zum Opfer gefallen sei. Im Verhältnis zum Wert sei der Diamant viel zu hoch bezahlt.
Man vertraute endlich, mit Zustimmung des Nisam, die Prüfung der Angelegenheit einer Kommission an, die ihn mit 23 Lakh gut bezahlt fand, also etwas weniger als die Hälfte des dem gerissenen Jakob bewilligten Kaufpreises. Das englische Syndikat jedoch ließ sich nicht darauf ein, sondern brachte die Sache vor Gericht, wo es aber zum Schluß abgewiesen wurde.
Die Aussagen des Nisam mußten in seinem Palast angehört[S. 174] werden, da er sich weigerte, vor Gericht zu erscheinen. Er empfand es als Erniedrigung, daß er nun für weniger als die Hälfte des verlangten und von ihm selbst zugesagten Preises in den Besitz des Diamanten gelangen sollte, so daß er nichts mehr von ihm oder der ganzen Sache wissen wollte.
Der Stein blieb viele Jahre hindurch bis zum Tode des Nisam in der Bank von Kalkutta in Verwahrung.
Der Kammerdiener Abid wollte nach dieser unangenehmen Angelegenheit — hatte er doch seinen Stammesgenossen eingeführt — nicht länger im Dienste bleiben. Er kam um seine Entlassung ein, denn während der zehn Jahre, die er beim Nisam war, hatte er es zum Millionär gebracht. Er kaufte ein großes Landgut in England und lebte dort mit seiner Familie von seinen Renten und der reichlichen Pension des Nisam.
Ob durch das Vorgehen des Sirkar der Not in Haiderabad wirklich gesteuert wurde, ist mehr als fraglich, wenn man allein die Kosten des Riesenprozesses in Rechnung zieht. Für Jakob aber bedeutete der Prozeß-Ausgang den vollständigen Ruin. Nicht zum wenigsten hatte er aber sein Unglück eigener Unvorsichtigkeit und seinem Übermut zu verdanken.
Der Sirkar Abdul Hugh, der Minister des Innern in Haiderabad, wurde auf Drängen des britischen Residenten zur Demission gezwungen, weil er nachweislich seine Hände in dem unsauberen Geschäft gehabt hatte. Der Sturz kränkte ihn so sehr, daß er bald darauf in der Verbannung starb.
Der Armenier Jakob, der in Indien als „Jacob of Simla“ allgemein bekannt wurde, war ein häßlicher Troll mit pockennarbigem Gesicht und alles andere als anziehend. Vielleicht hat seine mysteriöse und suggestive Art zu sprechen ihm seine allerdings nur kurzen Erfolge gebracht, obgleich ein einigermaßen normaler Mensch seinen Phantastereien keinen Glauben schenken konnte. Er war eben ein Armenier, Angehöriger einer Rasse, von[S. 175] der man in Indien sagt, daß ihr, wenn sie wegen Geschäften oder in Kriegen auf der Bildfläche erscheint, weder ein „Bania“ (indischer Wucherer) noch ein Jude, noch ein Grieche gewachsen sei. Leider hat sich dieses indische Wort bei Jakob nicht so recht bewährt, weder hinsichtlich des „Imperial Diamants“, noch in einem Geschäft mit dem Maharadscha von Kapurthala. In beiden Fällen erlitt das Prestige der Gerissenheit der armenischen Handelsleute einen schweren Stoß. Dort ohne „Bania“, Juden oder Griechen, einfach durch die kluge Diplomatie eines englischen Beamten, hier durch die Gewissenhaftigkeit eines Deutschen.
Das Geschäft, das Jakob in Kapurthala vorschlug, war, daß der Maharadscha ihm sein letztes Besitztum, ein Landhaus in Simla, abkaufen sollte. Jakob setzte alles auf diese Karte. Sonst hatte er kein Vermögen mehr, und selbst das Haus in Simla war nicht hypothekenfrei. Er kam zum Maharadscha, um eine neue Anleihe darauf aufzunehmen, und wußte ihm mit Worten so zuzusetzen und ihn sogleich so gut am rechten Fleck zu fassen, daß er — abergläubisch, wie nun indische Fürsten einmal sind — sich gleich für den Kauf des Hauses zu interessieren begann.
Schon glaubte Jakob sich gerettet, besonders wenn er unserem Finanzminister noch ein gehöriges Trinkgeld zukommen ließ. Bei Gelegenheit eines Besuches vergaß er daher eine Tausendrupiennote bei ihm, alles, was er eben flüssig machen konnte, und versprach außerdem eine weitere ansehnliche Provision nach Kaufabschluß.
Der Minister sagte feierlichst zu, was an ihm sei nicht zu verfehlen, damit der Kauf zustande komme, und Jakob reiste guten Mutes ab.
Bald darauf wurde ich, der ich damals erst kurze Zeit in der Staatsstellung zu Kapurthala war, zur Inspektion des Hauses beordert. Der Wahrheit gemäß berichtete ich, daß es in gutem Zustande, gut möbliert und allem Anschein nach auch mit einigen orientalischen Seltenheiten ausgestattet sei. Aber warum sollte der Maharadscha dieses Haus in Simla kaufen, da er doch am[S. 176] gleichen Orte schon ein anderes besitze? Und selbst das benutze er nicht, sondern zöge es vor, im Hotel abzusteigen! Die orientalischen Kuriositäten hätten für ihn, der sich viel mehr für europäisches Kunstgewerbe interessiere, doch kaum besonderen Wert. Und zum Schluß wäre das Geld für die bevorstehende Reise nach Europa besser zu verwenden.
Dies alles trug ich dem Maharadscha vor. Der letzte Punkt gab den Ausschlag, und der Kauf zerschlug sich. Ob dieser üblen Nachricht war Jakob sehr niedergedrückt. Er glaubte bemerken zu dürfen, daß er wohl das Trinkgeld dem unrichtigen Beamten zugespielt habe, was ihm aber eine echt deutsche Zurechtweisung eintrug.
War es mehr als meine Pflicht und Schuldigkeit gewesen, die Interessen des Maharadscha zu wahren, und hatte nicht der erfahrene Jakob ganz genau gewußt, daß der britische Sirkar bei der Wohnungsnot in Simla, und der Schwierigkeit, für Dschagatdschit Singh überhaupt die Erlaubnis zu erhalten, in Simla zu erscheinen, dem Maharadscha von Kapurthala niemals ein zweites Besitztum dort gestattet haben würde?
Was aber das Auftreten Jakobs in den Werken Kiplings anlangt, wo er als Surkan Sahib die Rolle eines bedeutenden Beamten im britisch-indischen politischen Geheimdienst spielt, so nehme ich an, daß Jakob ebenfalls durch seine Redensarten großen Eindruck auf den etwas leichtgläubigen Kipling gemacht hat. Daß er in Wirklichkeit dem britischen Sirkar als Geheimagent wertvolle Dienste geleistet hätte, ist mir ganz unbekannt. Jakob selbst hat mir nie davon gesprochen.
Sollte der Sirkar ihm wirklich wegen der Entdeckung von Verschwörungen und ähnlichem zu Dank verbunden gewesen sein, so hat er ihm mit dem Prozeß in Haiderabad schlecht gelohnt. Als er am Bettelstab war, hat ihm der Sirkar keinen Penny Unterstützung zukommen lassen. Von dem Nisam von Haiderabad dagegen erhielt er einen monatlichen Zuschuß von fünfhundert Rupien.


[S. 177]
Aus manchen Schilderungen in Kiplings Werken, der unstreitig der am meisten gelesene Schriftsteller über Indien in der angelsächsischen Welt ist und der jahrelang als Leiter der Zeitschrift „Pioneer“ dort gelebt hat, könnte man schließen, daß der Inder ein außergewöhnlich kluger Diplomat und Politiker sei. Ich kann jedoch nach meiner langen Erfahrung dies nicht unterschreiben, trotzdem ich den Inder vom Maharadscha bis zum Bauern kennengelernt habe, und in der Landessprache, wenigstens des Nordens, mit ihnen verkehrte. Statt der klugen und geschickten Politiker habe ich nie etwas anderes gefunden, als verschlagene und arglistige Schlauköpfe, denen jeder Weitblick fehlte.
Einer der Fürsten, die in der rücksichtslosesten Ausbeutung ihrer Untertanen vorbildlich waren, ist der bis 1900 regierende Maharattenfürst, der Holkar von Indore, einer der bedeutendsten Staaten Zentralindiens, gewesen.
Bei einem persönlichen Besuch bei ihm habe ich sein exzentrisches Wesen selbst beobachten können, und von glaubwürdiger Seite habe ich manche seiner erstaunlichen Tollheiten zu hören bekommen. Er war von seiner eigenen Erhabenheit so eingenommen, daß es sehr schwer fiel, sich ihm überhaupt zu nähern. Nur weil ich aus einem anderen indischen Staate kam, ließ er sich zu einer Audienz von wenigen Minuten für mich herbei.
Indore war damals um vieler Dinge willen ein Schmerzenskind des britischen Sirkar. Das Mißtrauen kam schon darin zum Ausdruck, daß man in der Stadt Mhow, einige englische Meilen von Indore entfernt, stets ein sehr starkes Kontingent englischer Truppen hielt. Dies war auch nicht unnötig, da der britische Resident den Holkar hin und wieder sehr scharf zurechtweisen mußte.
Als einer seiner Leibköche einmal den Reis nicht genügend weich gekocht hatte, befahl er, ihn selbst abzubrühen, wobei der Unglückliche[S. 178] gänzlich abgekocht wurde. Anstatt nun den Leichnam im geheimen zu verbrennen, warfen ihn die Bediensteten, wahrscheinlich um das Geld für das Holz in die eigene Tasche stecken zu können, in den Fluß „Nerbuda“, der die Stadt durchfließt. Unterhalb Indore, in Dhar, einem anderen Maharattenstaate, dessen Fürst aber in Grenzstreitigkeiten mit dem Holkar lag, wurde die Leiche gelandet und nach der Herkunft geforscht. Der Fall kam der britischen Behörde zu einer Maßregelung des Holkar sehr gelegen, denn es war nicht schwer gewesen, den Zusammenhang festzustellen.
Ein anderes Mal geriet der Holkar über einen seiner Palastdiener so in Zorn, daß er ihn mit einem eisernen Ring an eine Hundehütte schmieden ließ. Der Diener fügte sich der fürstlichen Laune und benahm sich, wenn er des Holkar gewahr wurde, wie ein Hund.
Vielleicht hat dies den Holkar einen Schimmer von Reue empfinden lassen. Denn als er einige Tage später von dem Angeketteten mit heftigem Bellen begrüßt wurde, gab er den Befehl zu seiner Befreiung, ließ ihn vor sich kommen und sagte:
„Freund! Du hast dich gut bewährt. Du sollst dafür belohnt werden“, und wollte ihm seine Tochter zur Frau geben.
Er gab auch wirklich den Befehl, die Hochzeit zu richten. Die Maharani und die Mutter des Mädchens beschworen aber den britischen Residenten, einen solchen Übergriff des Holkar zu verhindern, und nur durch dessen Hilfe scheiterte das sonderbare Vorhaben, das erst im Lichte der indischen Kastenbegriffe seine ganze Tragik für das bedrohte Mädchen erkennen läßt.
Als ihm die Bevormundung durch den englischen Residenten zu arg wurde, wollte er sich kurzerhand bei der Königin Victoria beschweren. Mit seinem Gefolge schiffte er sich in Bombay ein. Aber bald nach dem Auslaufen überfiel ihn die Seekrankheit. Er verlor die Lust an der Reise und befahl dem Kapitän des Dampfers, umzukehren, damit er wieder in Bombay an Land käme.
Als er zur Antwort erhielt, daß das Schiff ein königlicher[S. 179] Postdampfer sei und nur die Königin allein die Berechtigung habe, seinen Kurs zu ändern, wurde er so aufgebracht, daß er in Aden die Reise abbrach, um mit dem nächsten Dampfer nach Indien zurückzukehren. Er hätte dem britischen Sirkar keinen größeren Gefallen erweisen können!
Der Vater dieses Maharadscha dagegen war ein sehr einsichtiger Mann gewesen, der für die Zeiten einer Hungersnot einen recht bedeutenden Betrag in den Gewölben eines Bergschlosses hatte verschließen lassen. Vor seinem Tode hatte er den Schlüssel dazu dem britischen Residenten ausgehändigt.
Der Holkar dachte nun, dieses Geld nützlicher für seine eigenen Zwecke verwenden zu können und ließ sich einen Nachschlüssel machen.
Als der Resident dies erfuhr, bemühte er sich weiter nicht, den Holkar von seinem Vorhaben abzubringen, sondern ließ in der Nacht vor dem kritischen Tage in das Gewölbe einen offenen Korb mit Kobraschlangen stellen. Er wußte, daß er damit für alle Zeit dem Maharadscha die Lust an dem Besuch verleiden würde. Kaum hatte der Holkar die gewaltige Tür der Schatzkammer geöffnet, als der Schein der Laternen auf den Knäuel Schlangen fiel, die sich zischend dem Eintretenden entgegenreckten. Erschreckt räumte der Holkar eiligst das Feld.
Es war eine große Erleichterung für den Sirkar, als nach erzwungener Abdankung der Holkar bald darauf starb und in Ermanglung eines Sohnes ein geeigneter Nachfolger aus der Verwandtschaft eingesetzt werden konnte.
Wenn der Maharadscha Holkar von Indore seine Tochter in einem plötzlichen Einfall einem Diener seines Haushaltes zur Frau geben wollte, so griff dies vor allem auch in die Obliegenheiten einer in Indien besonders wichtigen Klasse von Menschen ein, nämlich der der Barbiere.
Zwar ist das Schneidenlassen der Haare den Sikh durch ihre[S. 180] Kastenvorschriften auf das strengste verboten, was noch einen besonderen Grund darin hat, daß die Sikh als Krieger in dem fest um den dichten Knäuel ihrer langen Haare gewundenen Turban ihre Hauptwaffe zu tragen pflegen. Es ist dies eine am Rande haarscharf geschliffene, tellergroße Stahlscheibe, die, mit einem Loch in der Mitte versehen, bei Gebrauch auf den Zeigefinger gesteckt wird.
Durch wirbelnde Bewegung in schnelle Drehung versetzt, wird sie auf den Gegner geschleudert, der sie infolge ihrer Dünne kaum sehen und ihr daher nur sehr schwer ausweichen kann. Bis auf dreißig Schritt ist der getroffene Feind unfehlbar verloren, da die verhältnismäßig schwere, scharfe Scheibe selbst die Schädelknochen glatt durchschlägt und im richtigen Treffen einem Menschen ohne weiteres den Kopf vom Rumpfe trennt.
Wenn daher auch das Haarschneiden nicht zu den Obliegenheiten eines nordindischen Barbiers gehört, so unterstehen seiner Kunst doch alle anderen Körperhaare, die überhaupt im Orient bei beiden Geschlechtern vollständig entfernt zu werden pflegen, wie auch die Verschönerung von Händen und Füßen. Infolgedessen kommt kaum jemand in so nahe und intime Berührung mit den einzelnen Personen der indischen Welt, wie gerade der Barbier. Außerdem betreibt er meistens noch das einträgliche Geschäft des Geldverleihers.
Er ist daher auch die gegebene Person, um Heiraten zu vermitteln. Er kennt die inneren Verhältnisse fast aller Familien und kann in der Stille der dunklen Gemächer während seiner Verschönerungsarbeiten Vorschläge machen, Aufträge entgegennehmen, unauffällig Erkundigungen einziehen, wie sonst niemand.
Die Person eines „Hadscham“, eines Hofbarbiers, ist fast immer erblich, und die sich dem Inhaber bietenden Gelegenheiten, zu Reichtum zu gelangen, sind besonders groß. Kann er doch gegen entsprechende Belohnung und Vorausbezahlung Bittgesuche befürworten, erwiesene Dienstleistungen in Erinnerung bringen und im richtigen Augenblick die Stimmung des Fürsten benutzen,[S. 181] um irgendwelche Gnadenbeweise vorzuschlagen. Oft werden diese Hofbarbiere dem Fürsten so unentbehrlich, daß sie zu Ministern gemacht werden, wie dies noch vor kurzem in dem bedeutenden Staate des Radscha von Cotschin in Süd-Indien geschah. Ebenso ist ein Barbier zum Mitglied des Staatsrates der Provinz Pundschab, der größten Indiens, ernannt worden.
Daß diese im geheimen so einflußreichen Herren hin und wieder auch auf ganz eigentümliche Gedanken kommen, wie man sie ebenfalls in Europa besonders oft bei Haarkünstlern finden soll, ist nicht verwunderlich und beweist, daß trotz aller Verschiedenheiten zwischen Ost und West irgendwelche eigentümlichen Übereinstimmungen im Untergrund der Menschen doch bestehen müssen.
So war der Hadscham von Kapurthala, Ischar Ram, von dem einen Wunsch verzehrt, einmal in seinem Leben, wie der Maharadscha selbst, in einem — Extrazuge zu fahren. Er wußte aber nicht, wie er dies anstellen sollte. Alles hatte er im Leben gerade wie sein Herr, der Maharadscha, genossen, nur dies eine, die Fahrt in einem eigenen Extrazuge, fehlte ihm noch. Ehe er sterbe, müsse er unbedingt auch noch dieses Vergnügen gekostet haben.
Ein schlauer bengalischer Babu (Schreiber) bestärkte ihn ständig in diesem sonderbaren Gedanken und bewog ihn endlich, ihm einen Vorschuß von tausend Rupien zu geben, damit er mit der Bahnverwaltung wegen eines Extrazuges von Katarpur nach Amritsar verhandeln könne.
Umsonst suchte ich Ischar Ram von seinem Gedanken abzubringen und ihm wenigstens klarzumachen, daß, wenn er nun einmal wie der Herrscher von Kapurthala reisen wolle, er zum Schluß weiter nichts zu tun brauche, als den Zug bei der Bahnverwaltung zu bestellen. Der sei es ganz gleichgültig, ob der Maharadscha oder irgend jemand anders ihn benutze, vorausgesetzt sie erhielte ihr Geld.
Eine so einfache Lösung der Frage erschien Ischar Ram aber ganz undenkbar. Um einen Extrazug zu erhalten, meinte er,[S. 182] müßten sicherlich ganz besondere Vorkehrungen getroffen werden, und im übrigen traute er mir als unreinem Europäer nicht zu, die Feinheiten der überragenden Bedeutung eines indischen Maharadscha durchschauen zu können.
Er zog es daher vor, dem bengalischen Babu tausend Rupien anzuvertrauen, um die sicherlich höchst schwierigen und geheimen Verhandlungen mit der Bahn in die Wege zu leiten. Natürlich hatte der Babu nichts Eiligeres zu tun, als mit den tausend Rupien in der Tasche einen ganz gewöhnlichen Zug zu benutzen, und damit auf Nimmerwiedersehen zu verschwinden. Und bald darauf begab sich Ischar Ram selbst ohne Extrazug ins Jenseits.
Der Barbier ist auch einer der wenigen Menschen, den der Hindu über seine Schwelle in das Innere seines Hauses läßt. Denn besonders in den höheren Kasten gibt es keinen größeren Frevel, als wenn Außenstehende die Innengemächer des Hauses betreten. Noch entsetzlicher ist aber der Gedanke, mit Weib und Kind das Heim zu verlassen und in unvermeidliche Berührung mit Fremden zu kommen. Dies war auch der Hauptgrund, weshalb es dem Maharadscha von Kapurthala so schwer fiel, eine Rani zu finden, die ihn nach Europa begleiten wollte.
Zur Verhütung der ungeheure Opfer fordernden Pest oder doch wenigstens der Einschränkung ihrer Folgen, ist von der Regierung vorgeschrieben, daß Pestkranke und Pestverdächtige, sowie Familien, in denen ein Pestfall vorgekommen war, isoliert werden müssen. Da dies das Verlassenmüssen des Familienhauses bedingt, wird alles getan, die Krankheit zu verheimlichen, mit der natürlichen Folge, daß meistens die ganze Familie stirbt. Aus diesem Grunde wird zu Zeiten einer solchen Epidemie der Polizei die Befugnis gegeben, die Häuser zu betreten und dort nach verdächtigen Kranken Nachforschungen anzustellen.
Gegen 1908 wütete nun in dem zu Kapurthala gehörenden Bezirke Phagwara, in dessen gleichnamiger Hauptstadt etwa 14000[S. 183] Einwohner leben, die Pest besonders stark. Der Tasildar (der Bezirksvorsteher) hatte nichts Eiligeres zu tun gehabt, als seinen Posten zu verlassen und nach Kapurthala zu fliehen. Da Phagwara als Enklave im britischen Gebiet liegt, nahmen die britischen Behörden Veranlassung, eine ärztliche Kommission in das verseuchte Gebiet zu senden, wo sie jedoch außer einigen Polizisten keine Beamten vorfand.
Diese Polizisten waren um des Gewinnes willen dort geblieben, denn der Tasildar hatte vor seiner Flucht noch angeordnet, daß jedes pestverdächtige Haus und jedes Haus, in dem ein Pestfall vorgekommen war, geräumt werden müsse. Die ebenso rücksichtslosen wie „gewissenhaften“ Polizisten benutzten nun den Befehl, um die Einwohner, die auf Grund ihrer Kastenvorurteile lieber an der Pest sterben als ihre Häuser verlassen, möglichst zu brandschatzen.
Die Stadt Phagwara ist ein blühender Handelsplatz und die Einwohner zu einem ziemlichen Prozentsatz wohlhabend. Es gab genug „Bania“ und „Schroff“ (Getreidehändler und Wucherer), die sich und ihr Haus vor Verunreinigung durch das Betreten von Fremden schützen wollten und dafür Opfer zu bringen bereit waren. Zu einer Verunreinigung genügt es, daß ein Fremder einen Blick auf eins der weiblichen Familienmitglieder wirft oder auch nur in ihren Schatten tritt.
Und den Polizisten stand das Recht zu, die Häuser zu betreten und zu durchsuchen! Mancher der Betroffenen grub da seinen heimlichen Schatz aus, um diese Schmach abzuwenden oder um nicht sein Haus verlassen zu müssen. Der Polizist mit der offenen Hand stand schon vor der Tür.
So kam es, daß in den meisten Fällen die Armen ihre Häuser gegen den Aufenthalt in den Isolierungslagern aufgeben mußten, während die Reichen ungestört in ihren Wohnungen an der Pest sterben durften und den Krankheitsherd fromm und wohlgesinnt im Gange hielten.
Die britische Regierung ließ den Maharadscha wissen, wie es[S. 184] in Phagwara stand, und verlangte kategorisch entsprechende Abwehrmaßregeln, widrigenfalls sie selbst die Angelegenheit in die Hand nehmen werde.
Anstatt des geflohenen, pflichtvergessenen Tasildar wollte der Maharadscha nun einen anderen senden, doch niemand fand sich dazu bereit, den gefahrvollen Posten zu übernehmen. Also wurden mir die erforderlichen Vollmachten in die Hand gedrückt, und ich reiste als Tasildar nach dem Pestorte.
Ich fürchtete mich nicht vor der Krankheit, die die reinlich lebenden Europäer nur selten befällt, und es gelang mir, etwas Ordnung in den Verhältnissen zu schaffen, den geldgierigen Schacherhandel zu stoppen und wenigstens etwas Hilfe zu bringen. Doch über ein Drittel der Bevölkerung starb. Die Straßenzüge waren leer. Nur Leichenzüge bevölkerten sie. Wer nicht im Isolierlager war, vergrub sich in seinem Hause.
Ein solches Isolierungslager in Indien ist für einen Europäer ein schrecklicher Anblick, denn die Leute müssen fast vollständig für sich selbst sorgen. Da die übergroße Zahl zu den Ärmsten der Armen gehört, liegen sie unter einer aus Schilfgras geflochtenen und auf vier Pfählen befestigten Matte, die nur geringen Schutz gegen die unbarmherzige indische Sonne und gar keinen gegen die recht empfindliche nächtliche Kälte gewährt, eng zusammengedrängt, stumpfsinnig in ihr Schicksal ergeben.
Als in Bombay 1895 die ersten Anzeichen der Pest auftauchten, hatte der damalige städtische Polizeidirektor dort nichts Eiligeres zu tun, als ein Syndikat zu bilden, um alle zur Zeit in Indien nur erreichbaren Desinfektions- und Heilmittel, die gegen die Pest in Betracht kommen, aufzukaufen.
Dann erschien die polizeiliche Bekanntmachung und der Befehl zu einer sorgfältigen Desinfektion der Häuser und Straßen. Da die hierzu notwendigen Mittel nur aus den Geschäften des Herrn Polizeidirektors zu beziehen waren, ist es nicht weiter verwunderlich, daß dieser Herr sich bald danach zur wohlverdienten Ruhe nach Schottland zurückziehen konnte.
[S. 185]
Wenn mir, wie als Tasildar in Phagwara oder auch in den Bungalows, die ich in den verschiedenen Orten bewohnte, sei es der Gaekwar von Baroda, der Maharadscha von Kapurthala oder einer der anderen Fürsten, an deren Höfen ich zu tun hatte, Wohnung und Haushalt zur Verfügung stellten, um meinen Obliegenheiten nachzugehen, wie Jagdtiere einzukaufen, Pferde auszuwählen, Gebäude zu besichtigen, Bestellungen aufzugeben oder Erkundigungen einzuziehen, so kam ich naturgemäß in enge Beziehung zu allen Klassen von eingeborenen Indern. Minister und Priester, Bauern und Händler, Jäger und Handwerker der verschiedensten Art und in den verschiedensten Provinzen und Landesteilen des großen Indien kamen, mich aufzusuchen, um in ihren eigenen indischen Angelegenheiten mit mir zu verhandeln. Oft auch wurde ich von den Höherstehenden, die auf Besuche fremder Gäste eingerichtet waren, das heißt, deren Häuser die hierfür notwendigen, besonderen Gemächer hatten, zu Gaste geladen. Noch öfter aber hatte ich Gelegenheit, Gäste aus den eingeborenen Kreisen bei mir zu sehen, die ich, als Vertreter der hohen indischen Fürsten, in deren Diensten ich stand, auf das beste bewirten mußte. Meistens luden sich die Herren selbst zu Gaste bei mir.
Wohl waren die Erfahrungen, die ich am Beginn meiner Laufbahn im Palast „Luxmi Vilas“ in Baroda bei den Einladungen des Gaekwar gesammelt hatte, nicht dazu angetan, eine Tischgesellschaft von Indern für sehr anziehend zu halten. Und hinsichtlich der allgemein üblichen indischen Art, sich bei Tisch zu betragen, ist dies auch stets und überall das Gleiche geblieben.
Jedoch die Schwierigkeiten der kastengemäßen Bewirtung waren bei Einladungen in meinem eigenen Hause nicht so groß, wie am Hofe von Baroda, wo keiner der Eingeladenen sich vor den anderen etwas vergeben wollte. Solange die Vorschriften der Kasten formell beachtet wurden, war es in dieser Hinsicht ziemlich gleichgültig, was ich meinen Gästen vorsetzte. Nur achtete ich stets darauf, niemals von der wirklichen Natur der Speisen zu sprechen,[S. 186] die ich den Gästen vorsetzen ließ, sondern die Gerichte stets als ihren eigenen Kastengeboten entsprechend zu bezeichnen.
So saßen an meinem Tisch, oftmals sogar zusammen: Maharatten, Ratschputen, Buddhisten, Brahminen, Gutscheraten, Mohamedaner, Parsi, Afghanen, Perser, Sikh und eine ganze Anzahl Angehöriger anderer Kasten, Völker und Glaubensbekenntnisse.
Der eine durfte kein Fleisch, der zweite keinen Fisch und andere wieder keins von beiden essen. Jenem war es untersagt, ein Ei anzurühren. Dieser nährte sich nur von bestimmten Gemüsen, oder es war ihm nur der Genuß des Fleisches ganz bestimmter Tiere gestattet, alle anderen waren ihm verboten. Manche durften wieder nur Speisen genießen, die auf genau vorgeschriebene Weise zubereitet waren, und oft spielte noch dazu die Art des Tötens des betreffenden Tieres eine große Rolle. Kurz, wenn ich je auf den Gedanken gekommen wäre, meine Gäste genau ihren Kastenvorschriften entsprechend zu bewirten, so hätte ich mir ebensoviele Köche halten können, wie ich Gäste bei mir sah.
In Wirklichkeit lief es allen Kastenvorschriften zuwider, überhaupt an meinem Tische zu essen, ein Verstoß, der dadurch noch unverzeihlicher wurde, weil ich bei diesen streng verpönten Mahlzeiten zugegen blieb.
Aber keiner der Herren war so kastentreu oder so wählerisch, wenn er sich bei mir zum Essen einlud. Zuweilen nur wurde mein Koch aufs Gewissen gefragt: es käme doch kein Rindfleisch auf den Tisch? Er schwor mit allen Eiden, daß seine eigene Kaste es ihm verbiete, eine derartige Todsünde, wie das Braten etwa eines Filets, überhaupt mit anzusehen, geschweige denn, selbst dabei Hand anzulegen.
Dabei war er ein Kastenloser, der den katholischen Glauben angenommen hatte. Auch dies war meinen Gästen genau bekannt. Doch voreinander gaben sie sich den Anschein, als ob sie der Versicherung des Koches Glauben schenkten, selbst wenn der betreffende Fragesteller eben im Begriff stand, sich ein saftiges[S. 187] Stück Rinderbraten auf den Teller zu legen. Die Hauptsache war, daß sie sich gegenseitig vorspiegeln konnten, sie handelten in gutem Glauben, und was das Essen selbst anbelangte, daß ich ihnen recht viel vorsetzte.
Daran fehlte es ja nun nie. Der Meister im Vertilgen von Speisen war ein Parsi-Arzt in Baroda, ein gewisser Doktor Bahrutscha, der niemals verfehlte, sich einzufinden, wenn ich Gesellschaft bei mir hatte, eine Tatsache, die ihm seine Leute, die es wieder von den meinen wußten, stets mitteilten.
Dieser Heilkünstler der Parsisekte, die, aus Persien stammend, wenigstens an keine Unmenge verschiedener Götter glaubt, sondern das Feuer als reinigende Emanation des Göttlichen betrachtet und in ihren religiösen Anschauungen transzendental genug gerichtet ist, um auch nach europäischen Begriffen philosophische Gespräche führen zu können, pflegte die Gesellschaft mit seinen Anekdoten zu unterhalten. Wie alle Parsi war er regeren Geistes, als die meisten Inder, was sicherlich damit zusammenhing, daß seine Begriffe nicht von Jugend auf in die Zwangsjacke der jedem vernünftigen Denken unzugänglichen Kastenvorschriften gepreßt worden waren.
Doch während des Essens gab er sich nicht mit Anekdotenerzählen ab und stieß, angeredet, nur ein unwilliges: „Tairo“ (Abwarten!) durch die Nase hervor. Als er zum ersten Male bei mir zu Tisch war, sah er mit schreckhaftem Bedauern, daß nicht ganz geleerte Platten wieder in die Küche getragen wurden. Beim nächsten Male ersuchte er meinen „Kansama“, den Aufseher der Tischdiener, doch darauf zu achten, daß man ihn als letzten bediene. Dies hatte jedoch nicht das geringste mit Bescheidenheit zu tun. Sondern, wenn er gesehen hatte, daß keiner der Anwesenden zu kurz gekommen war, häufte er sich alles, was er noch auf der Platte vorfand, ganz gleich, ob Braten oder Geflügel oder Fisch oder eins der tausend Reisgerichte, in deren Zubereitung sich die indische Küche auszeichnet, auf den Teller und machte sich an die Arbeit. Koteletten stopfte er sich ganz in[S. 188] den Mund, wie überhaupt alle diese Herren es bei weitem vorzogen, mit den Fingern zu essen. Solange er zu meinen Gästen gehörte, gab es keine Reste.
Alle anderen beneideten ihn um seine unermüdbare Eßfähigkeit. Wie üblich, wurde von den Indern nie etwas zu den Mahlzeiten getrunken. Bier verschmähten sie überhaupt. Um den Durst zu löschen, genüge Wasser. Der Zweck des Trinkens liege in seinen berauschenden Folgen, ist die indische Auffassung. Dazu ist Bier aber ein viel zu langweiliges und mühevolles Mittel. Portwein, Sherry, Liköre, durch Zusatz von Kognak verstärkt, entsprechen dieser ersten Anforderung besser. Doch das vornehmste ist Sekt. Er erregt die schlaffen indischen Nerven noch am schnellsten und kräftigsten und gibt ihnen vorübergehend die vom Inder am meisten geschätzte jugendliche Spannkraft und organische Betätigungslust, die ihm, wohl auch infolge seiner früh einsetzenden Ausschweifungen, schon in jungen Jahren abhanden zu kommen pflegen.
Nach dem Essen ist es üblich, daß Tänzerinnen den bis zum Halse vollgestopften Gästen ihre Künste zeigen. Diese Tänze werden für den Europäer an Langweiligkeit nur durch die endlose Monotonie der Begleitmusik übertroffen. Die Tänzerinnen, in wallende Schale, anliegende glitzernde Mieder und weite, über den Knöcheln der bloßen Füße zusammengebundene Beinkleider gehüllt, bewegen sich in einem Rhythmus von unendlicher Einförmigkeit stundenlang auf einer Stelle, heben und senken die Arme, biegen den Oberkörper bald nach rechts, bald nach links, machen einige kleine Schritte vor- oder rückwärts, drehen sich mit unglaublicher Langsamkeit um sich selbst und machen mehr den Eindruck verschlafener Marionetten als den lebender Wesen. Ihre Vorführungen sind nur auf den Ausdruck ganz bestimmter Körperhaltungen berechnet, ohne daß sie darauf ausgingen, in Linie und Haltung seelische Erregungen zu versinnbildlichen. Dazu[S. 189] ertönt ein ohrenbetäubender Lärm ohne jeden, für europäische Ohren erkennbaren Rhythmus, und hin und wieder ein fürchterliches Geschrei der begleitenden Musikanten. Das Ganze muß mehr unter dem Gesichtspunkt lebender Bilder beurteilt werden, was jedoch dadurch erschwert wird, daß der Europäer sich erst durch mühevolles Nachdenken in die den verschiedenen Haltungen zugrundeliegenden Vorstellungen rein indischer, durchgängig dem Sinnlichen entnommener Phantasien, versetzen muß.
Doch der Inder kann den Tänzerinnen stundenlang zusehen und wird von den Tanzvorführungen und der uns vollständig unverständlichen Musik in das höchste Entzücken versetzt. Wahrscheinlich beruht dies auf der viel geringeren Reizbarkeit seiner Nerven, die bedeutend langsamer als europäische reagieren und die, um überhaupt in Schwingungen zu geraten, eine ständige, langdauernde Wiederholung desselben Eindruckes erfordern, also gerade das, was die Nerven eines Europäers am ehesten ermüdet.
Die Tänzerinnen in Indien, die diese Vorstellungen geben, heißen „Nautsch-Mädchen“ und erinnern in der Wertung ihrer gesellschaftlichen Stellung sehr an das Ansehen, das den Hetären Griechenlands zuteil wurde. Während die indische Durchschnittsfrau das unangesehenste, vernachlässigtste, um nicht zu sagen verachtetste Geschöpf innerhalb der indischen Gesellschaft ist — abgesehen natürlich von den Frauen der Fürsten, jedoch auch sie nur innerhalb gewisser Grenzen —, ohne jedes Wissen, ohne irgendwelche Begriffe, so sind die Nautschtänzerinnen nicht nur von den, überall den Frauen in Indien aufgelegten Sklavenfesseln frei, sondern sogar die anerkannten Herrscherinnen der indischen Gesellschaft.
Meistens stammen sie aus Tandschor und Travancor in Süd-Indien, denn den Mädchen Zentral-Indiens, wie denen der Nordwest-Provinzen und Kaschmirs oder gar Bengalens fehlt es an Schönheit und Körperhaltung für die Aufgaben des Tanzes. Frühzeitig schon werden sie für ihren Beruf ausgebildet; sie lernen lesen und singen und haben große Bewegungsfreiheit, trotzdem sie in vielen Fällen der Travancor-Brahminen-Kaste angehören.
[S. 190]
Ein jeder Fürstenhof verfügt über ein besonderes Nautsch-Korps, das etwa dreißig, auch vierzig oder fünfzig Tänzerinnen umfaßt und ungefähr dem Ballet eines europäischen Hoftheaters entspricht. Die Mädchen müssen von möglichst hellbrauner Hautfarbe sein und werden von den mit ihrer Erwerbung oder Einkauf betrauten Beamten sorgfältig ausgesucht. Ein zu dunkler Hautton würde ihn unweigerlich seine Stellung kosten. Die indische Art, sich zu kleiden, oder besser den Körper mit unförmlichen Gewändern zu Bündeln zu verunstalten, Ohren, Nase, Fußknöchel, Arme und Hände mit goldenen und silbernen, dicken Schmucksachen zu überladen, bringt ihre oft erstaunliche Schönheit nicht vorteilhaft zur Geltung. Gewöhnlich tragen sie außer dem faltigen Obergewand ein an der Wade festanliegendes Beinkleid, das, im Oberschenkel weit geschnitten, in vielen Falten herabfällt.
Sie genießen ganz besonderes Ansehen und gelten im Tempel und im Hause für unentbehrlich. Allen Festlichkeiten der Eingeborenen wird erst durch ihre Gegenwart der rechte Glanz verliehen. Ein Nautschmädchen schmückt die Braut am Hochzeitstage. Ihr Erscheinen genügt, ein im Kastensinne verunreinigtes Haus wieder rein zu machen. Alle Kasten verehren sie, und ganz allgemein haben sie stets das Recht, selbst in Anwesenheit der höchststehenden Persönlichkeiten sich zu setzen.
In vielen indischen Gegenden werden sie wie Prinzessinnen geachtet. Ihre Gehälter sind für indische Begriffe fürstlich, erhalten sie doch bis tausend Rupien im Monat, mehr, als den meisten indischen Ministerpräsidenten an offiziellem Gehalt zusteht. Daher haben sie auch niemals Veranlassung, ihre Gunst zu verkaufen, sondern sind ganz im Gegenteil frei, ihren Neigungen zu leben.
Ebenso verachtet, wie die Nautschmädchen geachtet werden, ist der schon als vorzüglicher Hindu-Schikari (Jäger) erwähnte Angehörige der Baurikaste. Sein Gott ist der Gott der Diebe, zu[S. 191] dessen größerer Ehre alle Beute- und Raubzüge unternommen werden. Sein Bild steht unter dem großen, schattigen Maringenbaum des Dorfes, das nur von Mitgliedern ihrer Kaste bewohnt wird, auf dem freien Platze vor dem Hause des „Patel“, des Dorfältesten.
Aber auch die Bauri haben ihre Verehrer. Das sind die Polizisten. Aus verschiedenen Gründen. Kein Bauri darf sein Dorf vom Untergang bis zum Aufgang der Sonne verlassen, er sei denn bei einer Jagd beschäftigt. Für die Einhaltung dieser Vorschrift soll der Patel mit seinem Kopfe stehen. In den Vasallenstaaten nun wird es mit dieser Vorschrift nicht so genau genommen, da die Polizei dort wenig Neigung zeigt, sich mit Dingen zu befassen, die außer unangenehmen Handgreiflichkeiten nichts einbringen. Dafür aber steht der Polizist gern in einem nahen Verhältnis zu dem Bauri. Fängt er ihn als Dieb, ist er keines besonderen Lohnes sicher. Fängt er ihn nicht, so hat er nur Arbeit und Mühe mit ihm. Daher folgt er meistens liebevoll seiner Laufbahn im verborgenen und versucht, mit dem Bauri auf gutem Fuße zu stehen, der nicht abgeneigt ist, im Verhältnis zur allgemeinen Schlauheit des Polizisten, ihn an den — meist recht bescheidenen — Gewinnen seiner Unternehmungen teilhaben zu lassen.
Jedoch einen wird der Bauri nie bestehlen: seinen Jagdherrn. Lieber stellt er sich ihm mit seinen scharfen Sinnen als eine Art Detektiv zur Verfügung. So unterstand mir in Baroda ein ganz besonders gefürchteter Bauridieb, namens Kalru. Wenn er der gewandteste Dieb und geschickteste Gauner der nahen und ferneren Umgebung war, so war er auch unstreitig der beste Jägersmann. Ich machte ihn daher zum „Dschamadar“ oder Aufseher über seine Schikarigenossen, die in meinen Diensten als Oberjagdmeister des Fürsten standen.
Hatte ich ihn so für mich und all die vielen Häuser, Gärten, Höfe, Ställe und Landgüter, die mir unterstanden, als Dieb unschädlich gemacht, so mußte er doch, obgleich er sich als Dschamadar[S. 192] für seine Verhältnisse glänzend stand, seinem Gott zu Ehren und um seines eigenen Ansehens bei seinen Kastengenossen, sowie um seines eigenen Vorteils willen, noch immer auf Diebesfahrten ausgehen. Dabei stieß er aber stets einige Meilen in das benachbarte britische Gebiet vor und schonte die Umgebung von Baroda. Besonders erfolgreich sollte er in der nächsten britischen Garnison gewesen sein. Jedenfalls war er dem dortigen Polizei-Inspektor ein Dorn im Auge, dem er von dem Polizeivorsteher in Ahmedabad als ganz gefährlicher Kunde aufgegeben worden war.
Nun ist es eine der üblichen Ausreden der englischen Polizei auf britischem Gebiete in Indien, stets zu betonen, der Grund, weshalb so viele Verbrechen begangen und so wenige Verbrecher gehenkt würden, liege darin, daß alle Diebesnester in den Vasallenstaaten gelegen seien, wohin ihr eigener Arm nicht reiche.
Der fragliche Polizei-Inspektor war ein ebenso leidenschaftlicher Jäger wie ich und mir befreundet. Eines Tages war er bei mir zu Besuch und nahm an einer großen, von mir zur Weihnachtszeit veranstalteten Jagd teil, zu der die Freigebigkeit des Gaekwar mir Gelegenheit gab.
Als die Gesellschaft abends im Meßzelte zusammensitzt, kommt die Rede auch auf meinen Dschamadar Kalru, und es fällt dem Polizei-Inspektor ein, daß dies doch der Mann sei, den man ihm von Ahmedabad aus als so gefährlich aufgegeben habe. Er bittet mich daher, den schlimmen Gauner doch einmal kommen zu lassen, um ihn sich anzusehen und ihm ins Gewissen zu reden. Kalru, der natürlich im Jagdlager war, erschien unterwürfig und unschuldig-bescheiden am Zelteingang.
Der Polizei-Inspektor hält ihm alle seine Schandtaten vor und droht, bei dem Gaekwar seine Auslieferung zu beantragen, wenn er nicht von seinen bösen Pfaden lassen wolle. Kalru beteuert seine vollkommene Unschuld und verspricht alles, was der Polizei-Inspektor will. Ich beruhige den Mann der öffentlichen Sicherheit mit Hinweisen auf Kalrus vorzügliche Eigenschaften als[S. 193] Jäger. Alle Anwesenden beginnen, Geschichten von der erstaunlichen Schlauheit und Gewandtheit der Bauri im allgemeinen zu erzählen und wie sie jeden, wer es auch sei, zu überlisten vermöchten.


Der Polizei-Inspektor, der nichts auf seine und seiner Leute Überlegenheit jedem Diebe gegenüber kommen lassen will, bestreitet das Lob und behauptet, daß, solange seine Sachen unter der Obhut seiner selbst und seiner braven Polizisten seien, ihm niemand etwas stehlen könne.
Diese Gelegenheit benutze ich zu einem Versuch, meinen Dschamadar zu schützen, und trage daher dem Polizei-Inspektor eine Wette an, daß Kalru ihm noch in dieser Nacht irgend etwas aus seinem Zelte entwenden werde, wenn ich ihm den Auftrag dazu gäbe. Natürlich müsse er straffrei bleiben, und alle seine Missetaten in der Vergangenheit sollten im Buche der hohen Polizei gelöscht und ausgestrichen werden. Es handelte sich dabei nur um Diebstähle ohne große Bedeutung, die mehr mit Schlauheit und Geschicklichkeit ausgeführt worden waren, als daß dabei irgendwelche besonderen Werte Kalru bereichert hätten.
Gegen den Freispruch meines Dschamadars auf dieser etwas eigentümlichen Grundlage setze ich eine Kiste Champagner. Die Wette wird unter Gelächter eingetragen und abgeschlossen. Da wir am nächsten Morgen wieder früh zur Jagd aufbrechen wollen, geht ein jeder bald darauf in seinem Zelte zu Bett. Ich aber lasse mir Kalru kommen, rede ihm meinerseits ins Gewissen und stelle ihm vor, welchen Vorteil er in dieser Nacht erringen könne, wenn es ihm gelänge, den Polizei-Inspektor zu bestehlen: Vergessen aller seiner Straftaten und Ehre und Ansehen bis nach Ahmedabad!
Kalru natürlich schwört bei dem Seelenheil seines Vaters und seiner Mutter, daß er niemals das geringste gestohlen habe und weist, wegen vollkommener Unerfahrenheit in solchen Sachen, meine Zumutung entsetzt von sich. Übrigens, wie könne er es wagen, einen so hohen Beamten, wie den Polizei-Sahib, auch[S. 194] nur anzusehen, geschweige denn einem so gewaltigen und mächtigen Manne etwas, und sei es das geringfügigste, zu entwenden.
Ich schätzte nun aber Kalru als Dschamadar sehr, und es lag mir viel daran, die Wette zu gewinnen, um ihn so wenigstens von den begangenen Sünden rein zu waschen. So drohte ich ihm denn mit der Auslieferung an die britischen Behörden und versprach ihm zum Schluß vor Zeugen, daß ich alle Folgen selbst auf mich nähme, wenn er in derselben Nacht noch irgend etwas aus dem Zelte des Polizei-Inspektors zu stehlen vermöge. Endlich stellte ich ihm noch eine ganze Flasche Eingeborenen-Schnaps in Aussicht, und er versprach mir, sein Bestes zu tun, um mir meine Wette zu gewinnen.
In der Frühe des nächsten Morgens kommt er, mit tausend Bitten um Vergebung und sich vor Unterwürfigkeit auf der Erde wälzend, an mein Bett. Dabei hält er mir ein weißes Bündel hin, von dem er sagt, daß er nur auf meinen ganz ausdrücklichen Befehl hin gewagt habe, es aus dem Zelte des Polizei-Inspektors zu entwenden. Es war das Betttuch des Inspektors, das Laken, auf dem er am vergangenen Abend fest und sicher eingeschlafen war!
Niemand begriff, wie es möglich gewesen sei, einen so außerordentlich frechen Diebstahl auszuführen. Endlich gestand Kalru, daß er auf meinen Befehl in das Zelt des Polizei-Sahib geschlichen sei — dies war für einen geschmeidigen Jäger kein so großes Kunststück, sobald er unter der Zeltwand ein Loch zum Durchschlüpfen gegraben hatte —, als der Polizei-Dschokitar, der Wächter des Zeltes, tief geschlafen habe. Im Zelt habe er sich neben das Bett des Inspektors auf den Boden gesetzt und sich überlegt, was er nun wohl am besten mitnehmen könne? Ein indisches Zeltbett ist schmal wie eine Schiffskoje. Statt der Matratze liegt man auf einem „Ressai“, einem dünnen, kühlen Kissen, das von einem Gurtnetz getragen wird, und über das das Laken gebreitet ist.
Kalru setzte sich nun neben den im Nachtanzug schlafenden[S. 195] Polizei-Inspektor und begann, behutsam das Laken der Länge nach bis an den Rücken des Schläfers zu einer dünnen, festen Rolle zusammenzurollen. Diese etwa einen Zentimeter dicke Rolle mußte vom Schläfer bei einer Bewegung lästig empfunden werden, und Kalru rechnete damit, daß er sich aus diesem Grunde im Schlafe auf die andere Seite drehen würde.
Er wartete geduldig, bis diese von ihm vorausgesehene Bewegung gemacht war, worauf er das Laken nur auf der anderen Seite bis zum Rande zusammenzurollen brauchte, um mit seiner Beute das Zelt verlassen zu können.

[S. 196]
Wenn es richtig ist, daß für die Beeinflussung der Handlungsweise eines Menschen die Kenntnis seiner Laster wichtiger ist, als die seiner Tugenden, so haben die Engländer ihre Politik in Indien durchaus folgerichtig auf diese Grundeigenschaften der von ihnen beherrschten Millionen eingestellt.
Unter Ausnützung der Selbstsucht der Fürsten, des Geizes der höheren Klassen und der Lügenhaftigkeit des niederen Volkes kommen sie dem einzelnen indischen Herrscher durch Gewährung von — an sich belanglosen — Sondervorrechten entgegen, sehen von einer rationellen Besteuerung der Besitzenden ab, um alle Lasten der Verwaltungskosten, die nicht gering sind, vornehmlich der in Armut und Unwissenheit versunkenen großen Masse der Landbevölkerung aufzubürden, der sie mit allen Mitteln das Märchen von der britischen Allmacht stets vor Augen halten.
Die Verwendung indischer Truppen im Weltkriege jedoch hat auch Angehörigen des indischen Volkes die Augen darüber geöffnet, daß das große britische Kaiserreich sich allen anderen Völkern der Erde zugesellen mußte, um ein einziges anderes europäisches Volk zu besiegen, und die vielen Niederlagen der englischen Truppen bis zum Ende des Kampfes haben den Nimbus der englischen Überlegenheit stark erschüttert.
Diese Tatsachen sind von den zurückgekehrten einheimischen Truppen in Indien verbreitet worden. Infolgedessen macht sich ein gewaltiges Anwachsen der indischen Selbständigkeitsbestrebungen bemerkbar. Ihnen suchen die Engländer durch verschiedene Mittel zu begegnen. Die Fürsten sollen in einer Art indischem Oberhaus vereinigt werden, das nominell als Vertretung indischer Belange gleichberechtigt neben dem Vizekönig zu stehen hätte. Um sie gefügig zu halten, wird mit der Verleihung von Auszeichnungen und Orden nicht gespart, und die Zahl der zugestandenen Ehrensalutschüsse wird immer mehr erhöht, um jeder Eitelkeit entgegenzukommen.
[S. 197]
Um den bemittelteren Klassen höhere Erträgnisse ihrer meist im Baumwollhandel, und zum Vertrieb in Indien selbst hergestellter fertiger Stoffe — was bisher fast ein Monopol der Spinnereien in England war — angelegten Kapitalien zu ermöglichen, ist sogar das Unerhörte geschehen, daß die Erhebung eines indischen Eingangszolles auch auf englische Baumwollstoffe trotz aller Proteste der englischen Textil-Industrie zugestanden worden ist.
Die große Masse des Volkes aber wird in Schrecken und Furcht gehalten, indem man bei etwaigen Volksaufläufen ohne weiteres durch Flugzeuge Bomben auf die Menge werfen läßt, was ein bedeutend rationelleres Mittel als die Verwendung von Truppen zu ihrer Zerstreuung ist.
Ein weiterer Anstoß zur Auflehnung gegen die englische Herrschaft wurde von den Mohamedanern Indiens in der britischen Politik gegen die Türkei gefunden. Das Kalifat des Sultans in Konstantinopel war in Gefahr, und die Anhänger des Propheten erhoben sich in Indien zu seinem Schutze. An ihrer Spitze stehen die Brüder Ali. Obgleich England sie jetzt wegen versuchter Aufwiegelung der mohamedanischen Soldaten in der indischen Armee zu langjährigen Gefängnisstrafen hat verurteilen lassen können, so treten die Auswirkungen der Erhebung doch klar zutage. Die den zur Bekämpfung der Türken vorgeschobenen Griechen gewährte englische Unterstützung wird immer geringer, und die nationale Türkei unter Führung Mustapha Kemal Paschas erwehrt sich mit beispielloser Tapferkeit der sie seit 1918 von allen Seiten bedrängenden, und über so außerordentlich viel größere Machtmittel, als das arme, isolierte, ausgesogene Anatolien, verfügenden Feinde. Unnachgiebig verteidigt sie ihre nationale Ehre und ihr Leben als unabhängiger Staat, unterstützt und angefeuert durch die Anteilnahme der indischen Glaubensgenossen.
Die wichtigste freiheitliche Bewegung in Indien trägt den Namen „Swadeschi“ und verlangt für Indien eine Verfassung, die der der britischen Dominions — Kanada, Australien, Süd-Afrika[S. 198] — entspricht. Ihr Führer ist der Hindu Ghandi, der den Kampf gegen England durch passive Resistenz, durch vollkommene Nichtbeteiligung aller Inder an allen Angelegenheiten, in denen Engländer zu tun haben, in dem Boykott aller englischen Stoffe und durch das Verbot für jeden Inder, einem Engländer auch mit der geringsten Handreichung zu dienen, führen will[14].
Der Hauptsitz dieser Bewegung ist sonderbarerweise das durch die Furchtsamkeit und Unehrlichkeit, aber auch durch die skrupellose Gerissenheit seiner Bewohner bekannte Bengalen, im Nordosten Indiens. Im Südwesten dagegen haben sich die „Moplah“ genannten Bergbewohner einer Gebirgsgegend erhoben und stehen schon seit langem im Kampfe gegen die Engländer. Selbst wenn diese sich nicht scheuen, die gemachten Gefangenen trotz der sengenden Hitze Indiens in geschlossenen Güterwagen zusammenzupferchen und sie tagelang, ohne auf die flehentlichen Bitten um Wasser der vor Durst und Hitze halb Bewußtlosen zu hören, durch ganz Indien zu transportieren, bis jeder Eisenbahnwagen mit einem entsprechenden Prozentsatz an Toten ankommt, ist es ihnen bisher noch nicht gelungen, des Aufstandes Herr zu werden.
So sehen wir auch hier wieder viel Unverständliches im Charakter des Inders, und sicherlich ist bei keinem Lande, das geheimnisvolle, seltsame China nicht ausgenommen, die Möglichkeit eines Begreifens der asiatischen Gedankengänge geringer und ein Erfassen der wirklichen Beweggründe aussichtsloser als für Indien, auch für uns, deren Vorfahren im Dunkel der Zeiten die fernen Berge und Ebenen Innerasiens verlassen haben, um, wie die Vorfahren der Inder zum Indischen Ozean, bis an die Ufer der westlichen Meere, bis nach Europa, vorzudringen.
Neu erschienen:
Unter den Kannibalen der Südsee
Studienreise durch die Melanesische Inselwelt
von
Dr. Friedrich Burger
Mit 31 Bildtafeln, zwei Landkarten, mehreren Kartenskizzen und reichem Buchschmuck
Die australische Inselwelt gehört zu den am wenigsten erforschten Gegenden der Erde. Über die große Mehrzahl der unzähligen kleinen und kleinsten Inseln ist auch heute noch der Schleier des Unbekannten gebreitet. Gibt es doch viele unter ihnen, die kaum jemals von eines Weißen Fuß betreten wurden, und wenn auch von den wichtigeren Inseln die Küstenstriche besiedelt sind, so blieb das Hinterland größtenteils unerforscht. Besonders gilt dies auch von dem Urwald im Innern der großen Insel Neu-Guinea.
Dr. Friedrich Burger, der Verfasser des vortrefflichen Buches, unternahm in den Jahren 1911 und 1912 im Auftrage es Linden-Museums in Stuttgart eine ethnologische Studienreise nach dem Melanesischen Archipel und den Salomo-Inseln, um mit den bis jetzt beinahe unbekannten Bergstämmen dieser Inseln in Verbindung zu treten. Auf dem Wege nach Neu-Britannien hielt er sich vier Monate auf den östlichen Molukken auf, wo er Gelegenheit hatte, die abgelegenen Kei-Inseln zu besuchen und ihre hochinteressanten Bewohner kennen zu lernen. Was der Forscher hierbei an Begebenheiten hochbedeutsamer Art erlebte, hat er in seinem neuen Buche niedergeschrieben. Neben einer lebendigen Schilderung der Abenteuer und Gefahren, die das Bereisen der Inseln und das Zusammentreffen mit den Eingeborenen mit sich brachte, enthält das Buch soviel Belehrendes über Sitten, Gebräuche, Aber-, Geisterglauben und Zauberei bei jenen größtenteils dem Kannibalismus frönenden, in unberührter Urkultur lebenden Volksstämmen, daß die bisherigen Forschungsergebnisse und die über jene Gegenden erschienene Literatur, insbesondere auch unsere Kenntnisse des einstigen deutschen Kolonialbesitzes in der Südsee, in bemerkenswerter Weise bereichert werden. Gründliche Beobachtungen aus der Tier- und Pflanzenwelt bilden den landschaftlichen Rahmen und geben dem Buch das Gepräge der Vielseitigkeit.
Das Werk stellt sich infolge der vorzüglich gelungenen Bestrebungen des Verfassers, Erlebnisse abenteuerlicher Art mit einer Bereicherung des Wissens zu verknüpfen, auch als vorbildliches Volksbuch und Buch für die reifere Jugend dar, das für Geschenkzwecke in hervorragendem Maße geeignet ist.
Zu beziehen durch jede Buchhandlung
Verlag Deutsche Buchwerkstätten, Dresden
Ferner ist erschienen:
John Hagenbeck:
Fünfundzwanzig Jahre Ceylon
(„Unter der Sonne Indiens“ Band I) Erlebnisse und Abenteuer im Tropenparadies. Bearbeitet und herausgegeben von Victor Ottmann. Mit 33 Bildtafeln.
Fünfundzwanzig Jahre lang hat John Hagenbeck in Ceylon als Kaufmann, Pflanzer, Sportsmann und Tierexporteur eine umfassende Tätigkeit ausgeübt und ist der populärste deutsche Kolonist im fernen Südosten gewesen, bis ihn der Ausbruch des Weltkrieges von der Insel verjagte und unter äußerster Lebensgefahr zu einer abenteuerlichen Flucht in die Heimat zwang. Was John Hagenbeck in den langen Jahren eines reichbewegten Überseewirkens im Verkehr mit weißen und farbigen Menschen, auf der Jagd im Dschungel, in allen Teilen der Wunderinsel erlebte, das hat nach seinen Aufzeichnungen und mündlichen Berichten der bekannte Schriftsteller und Weltreisende Victor Ottmann, der mit John Hagenbeck schon von Ceylon her durch freundschaftliche Bande verknüpft ist, in höchst unterhaltsame literarische Form gebracht.
John Hagenbeck:
Kreuz und quer durch die Indische Welt
(„Unter der Sonne Indiens“ Band II.) Erlebnisse und Abenteuer in Vorder- und Hinterindien, Sumatra, Java und auf den Andamanen. Bearbeitet und herausgegeben von Victor Ottmann. Mit 33 Bildtafeln und 2 Landkarten.
Obwohl dieser zweite, völlig selbständige Band ein in sich abgeschlossenes Ganzes bildet, steht er mit dem ersten Bande doch in enger Verbindung. Er behandelt zunächst die Erlebnisse und Abenteuer John Hagenbecks und seiner Freunde auf dem Festlande Vorderindiens, vom tiefen Süden bis hinauf zu den weißen Bergregionen des Himalaja, an den Stätten der uralten indischen Kultur, unter Eingeborenen, an glänzenden Fürstenhöfen und auf der Großwildjagd in Dschungeln und Steppen. Er führt dann über Hinterindien nach der fernen Wunderwelt von Holländisch-Indien hinüber, nach Sumatra und Java, den tropisch üppigen großen Inseln mit ihren überwältigenden Naturszenerien und ihrem hochinteressanten Volksleben. Von einzigartigem, fesselnden Reiz ist ferner ein bedeutender Abschnitt des Buches, der die abenteuerlichen Erlebnisse John Hagenbecks auf den Andaman-Inseln im Indischen Ozean behandelt, die bisher nur von einigen ganz wenigen Deutschen besucht worden sind, weil sie als Sitz der größten Strafkolonie von den Engländern in strengster Abgeschlossenheit gehalten werden.
Auf Großtierfang für Hagenbeck
Selbsterlebtes aus afrikanischer Wildnis von Chr. Schulz (vom Hause Carl Hagenbeck in Hamburg). Über 50 Illustrationen nach Originalaufnahmen.
Ein äußerst fesselndes Bild gibt Chr. Schulz über die beim Einfang wilder Tiere zur Anwendung gelangenden Methoden, wobei an die Kühnheit und Todesverachtung des Jägers hohe Anforderungen gestellt werden. Tief ergreifend ist u. a. die anschauliche Schilderung von dem tragischen Tod eines Freundes im Kampfe mit einem angeschossenen Büffel, wobei auch der Verfasser fast das Leben eingebüßt hätte. Wir folgen dem Weidmann und Tierfänger in den dichtesten Urwald, wo nur Buschmesser und Axt den Weg zu bahnen vermag, wir folgen ihm auf flüchtigem Roß in die weite Masai-Nyika, um an seinen Giraffen-, Zebra- und Antilopenfängen teilzunehmen. Der Verfasser ist auch ein ausgezeichneter Kenner von Land und Leuten. Unserer ehemaligen Kolonie Deutsch-Ostafrika, dem verlorenen Paradies, widmet er seine liebevollste Aufmerksamkeit. Ebenso erweist er sich als scharfer Beobachter der verschiedenen Eingeborenen-Stämme.
Zu beziehen durch jede Buchhandlung
Verlag Deutsche Buchwerkstätten, Dresden
Fußnoten:
This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this eBook.